… über Partizipation und niedrigschwellige Zugänge
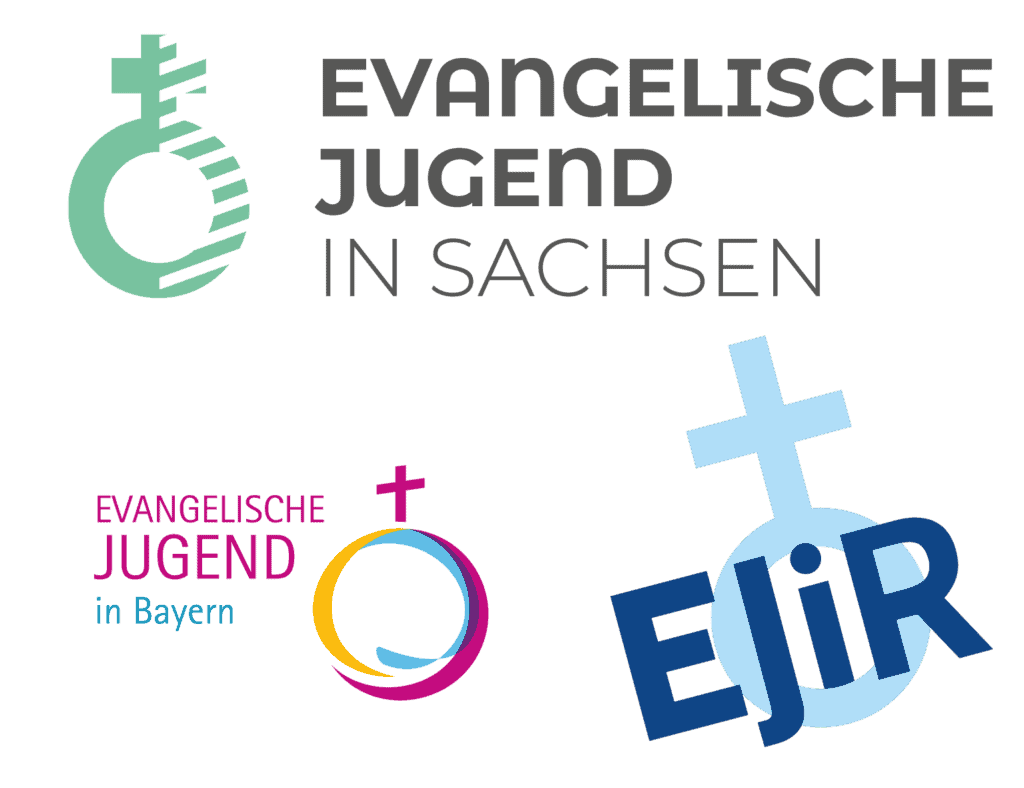
Lesezeit: 12 Minuten
Ausgabe 2/24 fancy, churchy, cringe
Annabel Baumgardt ist die stellvertretende Vorsitzende der EJ Bayern, Carla Peekhaus ist im Vorstand der Evangelischen Jugend im Rheinland und Hendrik Müller ist der Vorsitzende der EJ in Sachsen. Das Interview führte Arnica Mühlendyck (verantwortliche Redakteurin beim „baugerüst“ seit 2022) im Februar 2024 via Zoom-Call.
baugerüst: Kirche muss und wird sich verändern. Was muss die Kirche tun, damit sie für Jugendliche attraktiv bleibt?
Annabel: Damit Kirche für junge Menschen attraktiv bleibt oder wird – das kann man sehen, wie man möchte – muss sie sie als vollwertige Mitglieder ansehen und mehr auf sie hören. Junge Menschen wollen ihre Kirche mitgestalten und Mitglieder auf Augenhöhe sein. Damit einher geht der Wunsch, dass Kirche an sich jünger und moderner wird, Strukturen vereinfacht werden und Niedrigschwelligkeit geschaffen wird. Nicht nur Pfarrpersonen sollten verstehen können, wie die Institution Kirche funktioniert und teilhaben können an ihren Prozessen. Eine offene, niedrigschwellige Kirche wäre auf jeden Fall eine gute Basis.
Hendrik: Es geht außerdem um Partizipation und Verantwortungsübergabe: Es ist eine Sache, sich zu öffnen, aber eine andere, den Ehrenamtlichen zuzutrauen, Dinge selbst zu übernehmen. Man sollte ihnen Dinge in die Hand geben, die sie selbst entscheiden können. Auch in Finanz- und Personalfragen kann man ihnen einiges zutrauen. An diesen Aufgaben können sie wachsen.
baugerüst: Wie kann das konkret aussehen: Partizipation auf Augenhöhe?
Carla: Die festgefahrenen Strukturen müssen aufgebrochen werden. In der Kirche im Rheinland muss man sich zum Beispiel für vier Jahre wählen lassen für die Mitarbeit im Presbyterium. Dort ist man dann alleine mit lauter Menschen über 60 und man sollte am besten schon vollkommen den Durchblick haben, was in den letzten 40 Jahren in der Gemeinde gelaufen ist. Das ist doch krass, das kann doch nicht funktionieren! Wie wäre es denn, wenn sich ein Pool von Jugendlichen wählen lassen kann, die sich absprechen, abwechseln und gemeinsam auftreten können. Das nimmt Druck aus der Situation. Es ist auch schwierig, sich für so viele Jahre fest zu binden. Was ist denn, wenn ich zum Studium oder für eine Ausbildung aus meiner Heimatgemeinde wegziehe? Die Voraussetzungen für die Mitarbeit in kirchlichen Gremien müssen gesenkt werden. Warum können wir nicht sagen: Kommt einfach dazu, wir entwickeln Dinge gemeinsam?
Hendrik: Ich schließe mich an. Es geht viel um das Thema Begleitung. Wenn man als junger Mensch in Kirchenstrukturen kommt, findet man eine Themenvielfalt vor, die man erst mal gar nicht erfassen kann. Die Ehrenamtlichen müssen begleitet werden, damit sie gut eintauchen können. Und eine gute Begleitung ist nicht mit dem Einladen zur Sitzung erledigt. Es bräuchte eine Art Mentoring-System, eine Möglichkeit, sich gegenseitig an die Hand zu nehmen. Das kann man später zurückgeben, wenn jemand Neues ins Gremium kommt. Das müsste doch im Sinne unserer Kirche sein.
Annabel: Das ist eine gute Idee. Kirche darf nicht nur nach Quoten-Jugendlichen suchen. Da muss doch eine Bereitschaft da sein, ein solches Programm zu etablieren und die Legislaturperioden fluider zu machen. Vier Jahre im Leben eines jungen Menschen sind so lang – ich weiß doch jetzt noch nicht, was in vier Jahren ist! Wichtig ist auch, dass man jungen Menschen Mitspracherecht gibt. In Bayern wird gerade die Landesstellenplanung neu gestaltet. Junge Menschen haben sich in diesem Zusammenhang ebenfalls eingebracht, viele haben sich über Monate regelmäßig getroffen, um Lösungen für die Nutzung der vorhandenen Ressourcen zu finden. Und am Ende sagt der Dekanatsausschuss einfach und ohne Angabe von Gründen „Nö“? Das ist doch der Supergau für jeden Beteiligungsprozess. Warum sollten sich junge Menschen denn dann überhaupt beteiligen?
baugerüst: Ihr habt jetzt viel von Kirche als Institution gesprochen. Wie ist es mit der Evangelischen Jugend selbst – wohin muss die sich eurer Meinung nach bewegen?

Carla Peekhaus ist 21 Jahre alt und stammt aus der Nähe von Bad Kreuznach in Rheinland- Pfalz, wo sie nach der Konfirmandenzeit in der gemeindlichen Jugendarbeit gestartet ist. Seit 2021 ist sie im Vorstand der Evangelischen Jugend im Rheinland und seit September 2022 arbeitet sie ehrenamtlich als Vorsitzende des Ausschusses „Visionen“, der sich rund um das Papier „Aufbruch zwischen Wut, Mut und Visionen“ dreht. Sie studiert soziale Arbeit.
(Foto: privat)
Annabel: Ganz salopp und selbstreflektiert gesagt: In unseren Gremienstrukturen sind wir in der Evangelischen Jugend nicht viel besser. Aber in Bayern arbeiten wir seit zwei Jahren daran, dass es besser wird. In der Arbeitsgruppe EJB Prozess betrachten wir alle Strukturebenen und überlegen, wie die EJ von morgen aussehen könnte. Wir reflektieren alle bekannten Strukturen und denken sie neu. Die Ziele sind Niedrigschwelligkeit, Partizipation und eine zukunftsfähige Evangelische Jugend. Wir gehen diesen Prozess sehr selbstreflektiert an.
Hendrik: Wir sind noch nicht so weit in Sachsen. Wir hatten zwar in der Vergangenheit einen siebenjährigen Zukunftsprozess, das ist aber schon einige Jahre her. Daraus ergaben sich damals Leitlinien und Strategieimpulse, mit denen wir bis heute arbeiten. Wir haben vor einigen Jahren auch die komplette Jugendordnung überarbeitet, allerdings nicht die Grundstrukturen. Wir wollten sie nur nutzungsfreundlicher machen. Im Hinterkopf hatten wir zwar, dass man Dinge entschlacken und mehr Basisdemokratie einbringen müsste, aber ich glaube, da fehlt noch der Motor und die zündende Idee. Wie die Kirche sich wandelt, ist aber natürlich auch ein Thema in Sachsen. Die Landeskirche erprobt derzeit das Projekt „Kirche, die weitergeht“ und testet damit innovative Modelle für Kirche. Da überlegen wir natürlich, was wir davon für die EJ adaptieren können. Das steckt aber noch in Babyschuhen.
Annabel Baumgardt ist 23 Jahre alt und studiert in Regensburg musik- und bewegungsorientierte soziale Arbeit. Im Dekanat Altdorf war sie seit ihrer Konfirmation als Ehrenamtliche in der Evangelischen Jugend aktiv. Da es im Ehrenamt selten bei einer Funktion bleibt, ist sie mittlerweile unter anderem die stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Jugend Bayern.
(Foto: Michael Stöhr, ejb)

baugerüst: Was brauchen Kinder und Jugendliche abseits von Gremien von der Evangelischen Jugend?
Carla: Generell glaube ich, dass junge Menschen vor allem Räume brauchen. Wir jungen Menschen leben in einer Zeit der multiplen Krisen, das ist total belastend. Kinder und Jugendliche brauchen Räume, in denen sie aufgefangen werden und wo sie sich mit den Themen beschäftigen oder sich ablenken können. Das können Freizeiten und Ferienprogramme sein oder Projekte oder wöchentliche Treffs, da sind die Bedürfnisse ganz individuell und unterschiedlich. Wichtig ist, dass die Jugendlichen merken, dass sie wichtig und selbstwirksam sind, auch wenn viel auf der Welt passiert. Sie müssen erfahren: Wir sind nicht ohnmächtig und wir werden begleitet.
Annabel: Ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Trotzdem müssen wir überlegen: Jugendliche haben nicht mehr so viel Zeit. Der Rechtsanspruch auf den Ganztag kommt, das ist ein großes Thema für uns in der EJ. Wo ist unser Platz neben der Schule, um diese wichtigen, außerschulischen Räume zu schaffen? Wir haben noch keine Antwort darauf.
Hendrik: Neben den Räumen finde ich individuelles, sinnstiftendes Handeln für Jugendliche wichtig. Die Schule begleitet die Kinder eine lange Zeit, aber Schule ist Pflicht. Als Evangelische Jugend können wir einen Gegenpunkt setzen. Die Jugendlichen sollen erfahren: Dein Handeln ist sinnstiftend in einem Rahmen, der vollkommen freiwillig ist. Du kannst hier sein mit deinen Stärken und Schwächen. Ich finde, die EJ sollte der Resonanzboden für Kinder und Jugendliche sein.
baugerüst: Es ist kein Geheimnis: Es gibt weniger Hauptamtliche für mehr Arbeit – wie kann eure Vision gelingen mit immer weniger Menschen?
Carla: Man muss die Prioritäten verschieben. Multiprofessionelle Teams und das gemeinsame plurale Amt sind in dem Zusammenhang ja in aller Munde. Es ist klar, dass nicht alle Gemeinden in Zukunft eine Pfarrperson und eine Jugendleiterstelle finanzieren können, das ist in Rheinland-Pfalz heute schon keine Realität. Aber man kann ein gutes Konzept gemeinsam mit den jungen Menschen aufstellen. Brauchen sie die EJ wirklich zu Hause am Wohnort oder kann Jugendarbeit auch dort stattfinden, wo die Schule ist? Neben der örtlichen Priorisierung muss sich Kirche auch die Frage stellen, welche Angebote wirklich wichtig sind.
Annabel: Ich finde auch die Frage wichtig, welche außerkirchlichen Berufsgruppen in dem Zusammenhang wichtig sind. Warum sollte eine Pfarrperson beispielsweise Buchhaltung oder Informatik können? Das kann man auch nach außen beauftragen. Was jetzt schon passiert und woran wir nicht vorbeikommen: Es werden sich Regionen bilden, Gemeinden und Dekanate zusammengelegt werden. So kann mit weniger Hauptberuflichen trotzdem flächendeckend Jugendarbeit gewährleistet werden. Das kann nur mit der Unterstützung von ehrenamtlichen Jugendleiter:innen gelingen. Diesen Personen muss unbedingt Wertschätzung entgegengebracht werden und sie dürfen nicht in dem Sinne instrumentalisiert werden, dass sie hauptberufliche Arbeit ohne Bezahlung machen. Ein kritischer Punkt in diesem Prozess ist für mich, dass die Wege immer weiter werden, in den ländlichen Räumen fährt aber nicht immer ein Bus oder eine S-Bahn.

Hendrik Müller ist 28 Jahre alt und damit quasi der „Dino“ der Evangelischen Jugend in Sachsen. Er lebt in Dresden und arbeitet dort als Sozialarbeiter an einer Grundschule. Schon seit 2019 ist er der Vorsitzende der EJ in Sachsen. Seine Legislaturperiode und damit auch seine Zeit in der EJ enden im kommenden Jahr.
(Foto: Mathias Schneider – www.pcundfoto.de)
Hendrik: Wenn wir über die Zukunft des Hauptamts sprechen, sind zwei Dinge für mich wichtig. Das eine ist die Frage nach der Rolle. Wir müssen weg von der Vorstellung, dass Hauptberufliche alles selbst machen müssen. Es sollte vielmehr so sein, dass sie Ansprechpersonen und Multiplikatoren sind und sich auf Netzwerken, Ausbildung und Förderung konzentrieren. Ehrenamtliche müs- sen angeleitet werden, selbst Dinge zu organisieren. Die zweite Frage ist die Frage nach der Möglichkeit des Outsourcings. Wir sind in Sachsen im Regionalisierungsprozess, zwei bis drei Pfarrer oder Pfarrerinnen sind für bis zu 20 Dörfer zuständig. Es gibt trotzdem nicht überall einen kompetenten, vernünftig bezahlten Verwaltungsleiter. Das kann doch nicht sein.
baugerüst: Wie viel Lust haben Jugendliche überhaupt, sich ehren- amtlich zu engagieren?
Carla: Junge Menschen engagieren sich nur, wenn sie selbst grundposi- tive Erfahrungen gemacht und eine hohe Eigenmotivation haben – das sind die Grundvoraussetzungen. Ich erlebe junge Menschen als sehr engagiert in unfassbar vielen Bereichen. Im Sportverein, in politischen Organisationen, bei Fridays for Future, in Chören… Das Engagement unserer Generation geht nur irgendwie unter, außer, etwas wird medial groß gemacht. Aber das spiegelt die Realität nicht wider.
Annabel: Junge Menschen sind total vielseitig engagiert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das daraus wächst, wenn andere Vorbild sind. Die Schule nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch. Vielleicht spielt man noch ein Instrument, muss Hausaufgaben machen und soll möglichst ins Gymnasium gehen, man soll sich außerdem bewegen und Sport machen, weil das so wichtig ist. Da prasselt ganz viel Leistungsdruck auf junge Menschen ein. Viele Jugendliche jonglieren und müssen versuchen, die Balance zu halten und sich nicht selbst zu verlieren. Ich glaube, viele können sich gar nicht zusätzlich engagieren – Ehrenamt muss man sich auch leisten können.
Hendrik: Ich kann mich nur anschließen. Jugendliche sind heute sehr engagiert in einer Art und Weise, die von der Gesellschaft nicht ansatzweise erfasst wird. Man sieht ja oft nur die Spitze des Eisbergs, wie beispielsweise Fridays for Future und das wird dann leider oft abgetan. Ich nehme bei der jungen Generation trotz ihrer teilweisen Unverbindlichkeit einen großen Willen wahr, Dinge zu verändern, anzugehen und zu gestalten. Aber nur, wenn eine Wirkung dahintersteht und das Engagement nicht nur verpufft. Eine Resonanz – für sich selbst, den Sozialraum oder die Gesellschaft – muss da sein.
Du hast Interesse am Thema „Kirche der Zukunft und Zukunft der Kirche“?
Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 2/24 fancy, churchy, cringe.
Titelbild: Die Logos der Evangelischen Jugend in Bayern, Rheinland und Sachsen

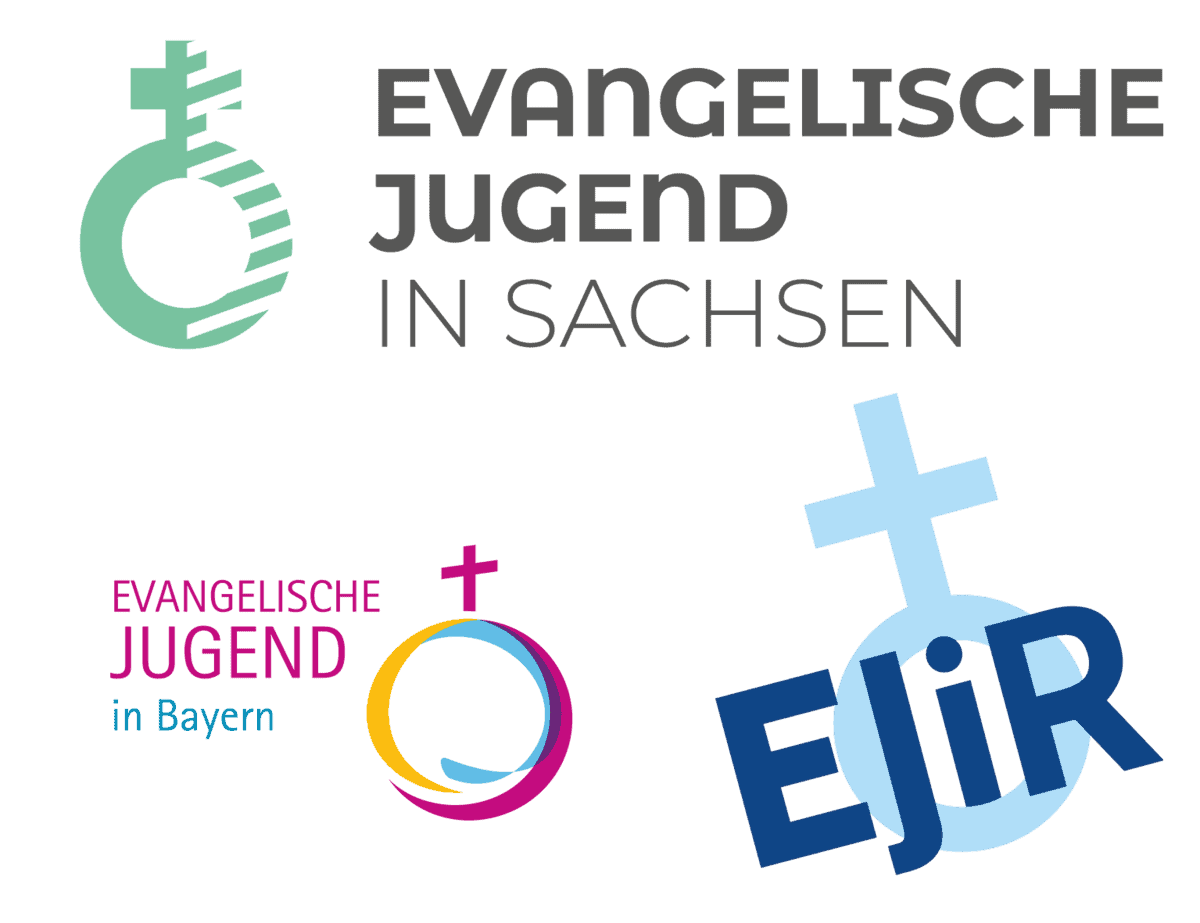
Rückmeldungen