Kinder, Eltern und die Religion

Lesezeit: 12 Minuten
Ausgabe 4/24 Was Kinder glauben
Dr. Marc Sieper ist Professor für Recht der Sozial- und Gesundheits-systeme an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Er schreibt regelmäßig Texte zu rechtlichen Fragestellungen für das „baugerüst“.
Eine Betrachtung aus juristischer Sicht
„Nun sag, wie hast du´s mit der Religion?“1
Margarete (Johann Wolfgang von Goethe: Faust)
So lautet die berühmte „Gretchenfrage“, mit der im ersten Teil von Goethes berühmter Tragödie Margarete die Absichten und die Gesinnung von Faust erkunden möchte. Über die dann folgende Antwort ist in der Literaturgeschichte viel geschrieben worden. Ungeachtet der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten bleibt festzustellen, dass sich Faust als volljähriger Mensch eindeutig zu dieser Frage positionieren kann. Wie sieht dieses aber mit Kindern aus? Welche Rechte haben Kinder und jugendliche Personen in Bezug auf Religion und ab welchem Alter können sie sich unabhängig von ihren Eltern darüber entscheiden, einer bestimmten Religion bzw. einem Bekenntnis anzugehören oder eben auch nicht?
Glaubens-, Bekenntnis- und Gewissensfreiheit im Grundgesetz (GG)
Auch wenn aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) folgt, dass in der Bundesrepublik Deutschland Staat und Kirche voneinander getrennt sind, schützt der Staat die Religionen und ihre Ausübung. Nach Art. 4 Abs. 1 GG sind die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird nach Art. 4 Abs. 2 GG gewährleistet. Anders als andere Grundrechte (z.B. Art. 12 Abs. 1 GG, Berufsausübungsfreiheit) ist der persönliche Schutzbereich nicht auf deutsche Staatsbürger*innen beschränkt, sondern steht gleichermaßen auch Ausländer*innen zu.2 Auf Art. 4 GG können sich somit vom Grundsatz her alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland berufen, das heißt, auch Kinder und jugendliche Personen.3 Die Grundrechte aus Art. 4 GG stehen darüber hinaus auch den Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften zu.
Das Grundgesetz garantiert die Religionsfreiheit als wichtiges, für einen Rechtsstaat essentielles, Grundrecht zwar ohne Vorbehalt, gleichwohl aber nicht schrankenlos. Seine Schranken finden die Grundrechte aus Art. 4 GG in anderem Verfassungsrecht, insbesondere in kollidierenden Grundrechten, die im Einzelfall gegeneinander im Wege der sogenannten praktischen Konkordanz abgewogen werden müssen.4 Allerdings sind Grundrechte stets nur (Ab-wehr-)rechte gegenüber dem Staat, wie sich ausdrücklich aus Art. 1 Abs. 3 GG ergibt. Auch wenn sich aus den Grundrechten allgemeine Wertungen entwickeln lassen, wirken diese nicht im privatrechtlichen Rechtsverkehr, wozu auch das im Familienrecht angesiedelte Eltern-Kind-Verhältnis gehört.
Ausübung des elterlichen Sorgerechts
Solange ein Kind oder eine jugendliche Person minderjährig ist, ist sie nach § 107 BGB noch nicht voll geschäftsfähig und steht unter der elterlichen Sorge. Die Eltern haben nach § 1626 Abs. 1 Satz 1 BGB die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen. Dies korrespondiert mit dem verfassungsrechtlich garantierten Elternrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG. Zur elterlichen Sorge gehören nach § 1626 Abs. 1 Satz 2 BGB die Personensorge und die Vermögenssorge. Grundsätzlich vertreten die Eltern ihr Kind innerhalb der elterlichen Sorge nach § 1629 Abs. 1 Satz 2 BGB gemeinschaftlich. Die Eltern haben nach § 1627 BGB die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben und müssen versuchen, sich bei Meinungsverschiedenheiten zu einigen.
Entscheidungen im Zusammenhang mit Religion sind ähnlich einzuordnen, wie die Entscheidung über den Schulbesuch oder über Schutzimpfungen.
Da es im Rahmen aller Sorgerechtsentscheidungen auf das Einvernehmen der Eltern ankommt, sie sich also einig sein müssen, kann es hier bei unterschiedlichen Auffassungen zu einem Thema zu Konfliktfällen kommen. Zwar müssen die Eltern nach § 1627 Satz 2 BGB versuchen, sich zu einigen, aber es stellt sich die Frage, was geschieht, wenn dieses nicht möglich ist. Die Gesetzgebung lässt die Eltern in einer solchen Situation aber nicht alleine, sondern eröffnet mit § 1628 BGB bei Meinungsverschiedenheiten in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, die Möglichkeit, dass ein Elternteil das Familiengericht anruft. Dort kann dann ein Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung gestellt werden, wobei aber zu beachten ist, dass sich das Familiengericht dann zwar beide Positionen der Eltern anhört und diese gegeneinander abwägt, dann aber in der Sache selbst keine eigene Entscheidung trifft. Das Familiengericht überträgt, nachdem es alle Argumente gehört hat, einem Elternteil für eben diese Frage die alleinige Entscheidungsbefugnis. Und dieser Elternteil darf dann in dieser für das Kind erheblich bedeutsamen Angelegenheit abschließend entscheiden.
Diese Möglichkeit besteht allerdings nicht für jede Uneinigkeit der Eltern, sondern – wie oben bereits ausgeführt – nur dann, wenn es sich um eine Entscheidung „von erheblicher Bedeutung“ handelt. Wann dies der Fall ist, entscheidet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Von wesentlicher Bedeutung für das minderjährige Kind sind beispielsweise Entscheidungen über die Frage des Besuchs einer (weiterführenden) Schule5 oder hinsichtlich Schutzimpfungen6.
Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung (RelKErzG)
Allgemein sind Eltern in Ausübung des elterlichen Sorgerechts nach § 1626 Abs. 2 BGB verpflichtet, die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen und Fragen der elterlichen Sorge mit dem Kind zu besprechen, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist. Die Eltern sind in diesem Zusammenhang gehalten, Einvernehmen mit dem Kind anzustreben.
Die Gesetzgebung geht davon aus, dass Kinder und jugendliche Personen mit steigendem Alter zunehmend in der Lage sind, auch wichtige Entscheidungen unabhängig von ihren Eltern und gegebenenfalls sogar konträr zu diesen zu treffen. So ist es in der Rechtsprechung sowie der Rechtsliteratur anerkannt, dass jugendliche Personen bereits ab Vollendung des 14. Lebensjahres ohne Einverständnis der Personensorge-berechtigten in medizinische Heil-eingriffe einwilligen können, wenn sie nach Einschätzung der behandelnden Person hierfür die notwendige Einsichtsfähigkeit haben; ab Vollendung des 16. Lebensjahres wird regelhaft hiervon ausgegangen.7
Im Hinblick auf Religion und Bekenntnis des Kindes oder der jugendlichen Person ist das Gesetz über die religiöse Kindererziehung (RelKErzG) einschlägig. Dieses Gesetz geht nach § 1 RelKErzG entsprechend der allgemeinen Sorgerechtsregelungen des BGB davon aus, dass die Eltern nach freier Einigung die religiöse Erziehung ihrer Kinder bestimmen. Zur Erziehung der Kinder gehört folglich auch deren religiöse Erziehung, so dass die Eltern vom Grundsatz her über Religionszugehörigkeit bzw. Bekenntnis und die Religionsausübung ihrer Kinder entscheiden. So ist es zunächst Sache der Eltern, die Entscheidung darüber zu treffen, ob ein Kind getauft wird oder ob es in der Schule am Religionsunterricht teilnimmt.
Zunächst entscheiden die Eltern: Wird das Kind getauft? Besucht es den Religionsunterricht?
Nach § 7 RelKErzG sind für Streitigkeiten die Familiengerichte zuständig, womit auf die oben bereits beschriebene Möglichkeit eines Antrages auf Übertragung der Entscheidungsbefugnis nach § 1628 BGB verwiesen wird. Auch Ent-scheidungen im Zusammenhang mit der Religion und des Bekenntnisses gelten als Reglungen von erheblicher Bedeutung für das Kind.8 Können sich Eltern somit nicht darüber einigen, welche Religion beziehungsweise welches Bekenntnis das minderjährige Kind erhalten soll, können sie sich nach § 1628 BGB an das Familiengericht wenden. So kann das Familiengericht zum Beispiel eine Entscheidung treffen im Hinblick auf die Wahl der Religion9, die Taufe und die Teilnahme an der Erstkommunion10, die Teilnahme am Religionsunterricht und am Schulgottesdienst11 oder gar hinsichtlich des Austritts aus der Kirche12.
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist aber die Regelung des § 5 RelKErzG. Aus § 5 Satz 1 RelKErzG folgt, dass nach der Vollendung des 14. Lebensjahres dem Kind die Entscheidung darüber zusteht, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich halten möchte. Ab Vollendung des 14. Lebensjahres entscheidet die dann jugendliche Person folglich alleine über diese Frage und kann sich gegebenenfalls sogar gegen die Entscheidung der Eltern durchsetzen. Die jugendliche Person ist mit Vollendung des 14. Lebensjahres religionsmündig.13
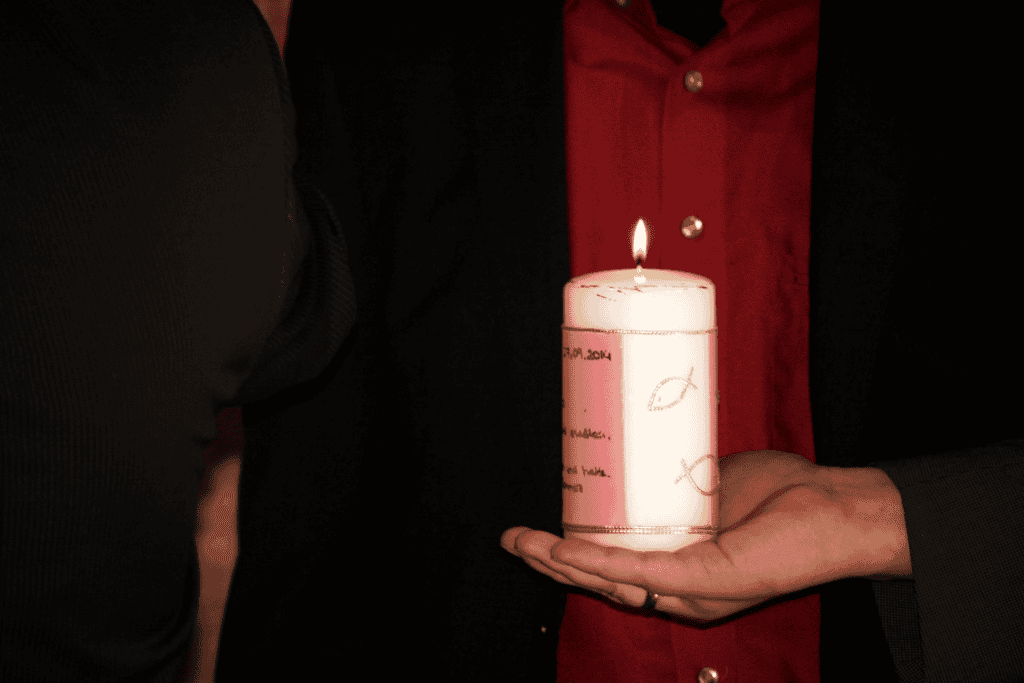
Bei der Taufe entscheiden meist die Eltern für das Kind – bei der Konfirmation entscheidet das dann religionsmündige Kind selbst.
Bei den großen christlichen Kirchen fällt dies zeitlich in etwa in die Entscheidung über die Konfirmation oder die Firmung, worüber dann ohne Mitentscheidung der Eltern befunden werden kann. Die jugendliche Person hat von diesem Zeitpunkt an aber auch das Recht zum Kirchenaustritt, und zwar unabhängig von der Frage, ob sie sich einem anderen Bekenntnis anschließen oder gar keinem Bekenntnis mehr angehören möchte.14
Mit 14 Jahren wird das Kind religionsmündig – es entscheidet nun selbst
Die jugendliche Person entscheidet dann auch über die Frage der (weiteren) Teilnahme am Religionsunterricht selbständig und kann sich auch bei ihrer Entscheidung darauf beschränken, dem bisherigen, rechtlich einwandfrei oder nicht bestimmten Bekenntnis weiterhin anzugehören, wobei ihr dann aber auch das Recht zusteht, frei über die Teilnahme am Religionsunterricht und an Gottesdiensten und Kulthandlungen zu bestimmen.15 Eine Überprüfung der geistigen Reife oder der inneren Beweggründe für derartige Entscheidungen findet aber nicht statt.16
Hat das Kind das 12. Lebensjahr bereits vollendet, darf es nach § 5 Satz 2 RelKerzG gegen seinen Willen nicht mehr in einem anderen Bekenntnis wie bisher erzogen werden. Ziel ist die Stetigkeit der religiösen Erziehung und die Vermeidung von Gewissensnöten des Kindes bzw. der jugendlichen Person.17 Diese gilt mit Vollendung des 12. Lebensjahres dann als teilreligionsmündig.18
Entscheidungen der Eltern mit religiösem Bezug als Kindeswohlgefährdung?
Aus dem Vorgesagten folgt, dass bis zu einer (Teil)religionsmündigkeit des Kindes bzw. der jugendlichen Person alleinig die Eltern berufen sind, alle Fragen im Zusammenhang mit der religiösen Erziehung des Kindes zu entscheiden. Dies muss als Ausfluss des verfassungsrechtlich geschützen Elternrechts aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG respektiert werden. Allerdings stehen alle Entscheidungen im Zusammenhang mit der elterlichen Sorge stets unter dem Vorbehalt des Kindeswohls, wie sich aus § 1627 Satz 1 BGB ausdrücklich ergibt.
Ist das Kindeswohl gefährdet, muss der Staat das ihm nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG übertragene Wächteramt wahrnehmen und zum Schutz des Kindes die geeigneten Maßnahmen einleiten. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte bekannt, die für eine Kindeswohlgefährdung sprechen, muss es nach § 8a Abs. 1 SGB VIII eine sog. Gefährdungseinschätzung durchführen. Erachtet das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, muss dieses nach § 8a Abs. 2 SGB VIII eingeschaltet werden. Das Familiengericht ist dann nach § 1666 Abs. 1 BGB verpflichtet, die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden, wenn die Eltern hierzu nicht willens oder nicht in der Lage sind.
Auch § 7 Satz 2 RelKErzG verweist für derartige Fälle auf § 1666 BGB. Ein Einschreiten von Amts wegen ist bei einer Gefährdung des Kindeswohls in Extremfällen denkbar, beispielsweise bei religiös motivierter systematischer und regelmäßiger Züchtigung als Erziehungsmethode.19 Im Übrigen wird dies in der Praxis aber eher selten vorliegen, wenn z.B. eine Gefährdung durch Sekten gegeben ist, wenn das Kind über längere Zeit hinweg den Einflüssen mehrerer Religionsgemeinschaften mit der Gefahr der Verwirrung seiner religiösen Vorstellungen ausgesetzt wird, wenn ein Bekenntniswechsel trotz fester Glaubenszugehörigkeit des Kindes erfolgen soll oder wenn bei einem Kind durch „einen unnötig schroffen Wechsel in der tatsächlichen religiösen Erziehung Gewissensnot oder schwere seelische Erschütterung“ hervorgerufen wird.20
Du hast Interesse am Thema „Kinderglaube“?
Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 4/24 Was Kinder glauben.
Titelbild: Bei einem jüngeren Kind entscheiden die Eltern: Besucht es den Schulgottesdienst und den Religionsunterricht? (alle Foto: Arnica Mühlendyck)
Literatur und Hinweise
- 1 Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, Vers 3415.
- 2 Jarass in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 4 GG, Rdn. 18.
- 3 Jarass in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 4 GG, Rdn. 18; Heinig in: Huber/Voßkuhle, GG, 7. Aufl. 2024, Art. 4 GG, Rdn. 37; Mager in: von Münch/Kunig, GG, 7. Aufl. 2021, Art. 4 GG, Rdn. 41.
- 4 Jarass in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 4 GG, Rdn. 28, 30; Heinig in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 4 GG, Rdn. 144.
- 5 OLG Brandenburg, Beschl. v. 09.02.2022, 13 UF 156/21 (unterschiedliche Grundschulen); OLG Dresden, Beschl. v. 31.03.2016, 20 UF 165/16 (Privatschule oder staatliche Schule); AG Frankenthal, Beschl. v. 25.06.2020, 71 F 79/20 (Waldorfschule oder Regelschule).
- 6 Bundesgerichtshof, Beschl. v. 23.05.2017 – XII ZB 157/16; OLG Frankfurt a. M. Beschl. v. 11.7.2023, 6 UF 53/23.
- 7 Wever in: Bergmann/Pauge/Steinmeyer, Gesamtes Medizinrecht, 4. Aufl. 2024, § 630d BGB, Rdn. 5; Katzenmeier in: BeckOK BGB, 70. Ed. (Stand: 01.05.2024), § 630d BGB, Rdn. 13; OLG Saarbrücken, Urt. v. 12.08.2020, 1 U 85/19; OLG Hamm, Beschl. v. 29.11.2019, 12 UF 236/19.
- 8 Z.B. OLG Karlsruhe, Beschl. v. 28.3.2019, 20 UF 27/19 (Entscheidung über die Taufe); OLG Stuttgart, Beschl. v. 24.02.2016, 17 UF 292/15 (Wahl der Religion); OLG Oldenburg, Beschl. v. 09.02.2010, 13 UF 8/10 (Austritt aus der Kirche); AG Monschau, Beschl. v. 30.05.2012, 6 F 59/12 (Teilnahme am Religionsunterricht und Schulgottesdienst).
- 9 OLG Stuttgart, Beschl. v. 24.02.2016, 17 UF 292/15.
- 10 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 28.3.2019, 20 UF 27/19 (Entscheidung über die Taufe); OLG Hamm, Beschl. v. 15.06.2011, 8 UF 131/11 (Taufe und Teilnahme an Erstkommunion).
- 11 AG Monschau, Beschl. v. 30.05.2012, 6 F 59/12.
- 12 OLG Oldenburg, Beschl. v. 09.02.2010, 13 UF 8/10.
- 13 Schmid, RelKERzG, 1. Aufl. 2012, § 5 RelErzG, Rdn. 1
- 14 Huber in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2024, § 5 RelKErzG, Rdn. 2.
- 15 Huber in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2024, § 5 RelKErzG, Rdn. 2.
- 16 Huber in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2024, § 5 RelKErzG, Rdn. 2.
- 17 Huber in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2024, § 5 RelKErzG Rdn. 4; Schmid, RelKERzG, 1. Aufl. 2012, § 5 RelKErzG, Rdn. 3.
- 18 Schmid, RelKERzG, 1. Aufl. 2012, § 5 RelKErzG, Rdn. 3.
- 19 EGMR, Urt. v. 22.03.2018, Nr. 68.125/14, 72.204/14 (Wetjen u. a. ./. Deutschland) „Zwölf Stämme“.
- 20 Schmid, RelKErzG, 1. Aufl. 2012, § 7 RelKErzG, Rdn. 2 mit weiteren Nachweisen aus der (eher älteren) Rechtsprechung.


Rückmeldungen