Hass in den Sozialen Medien
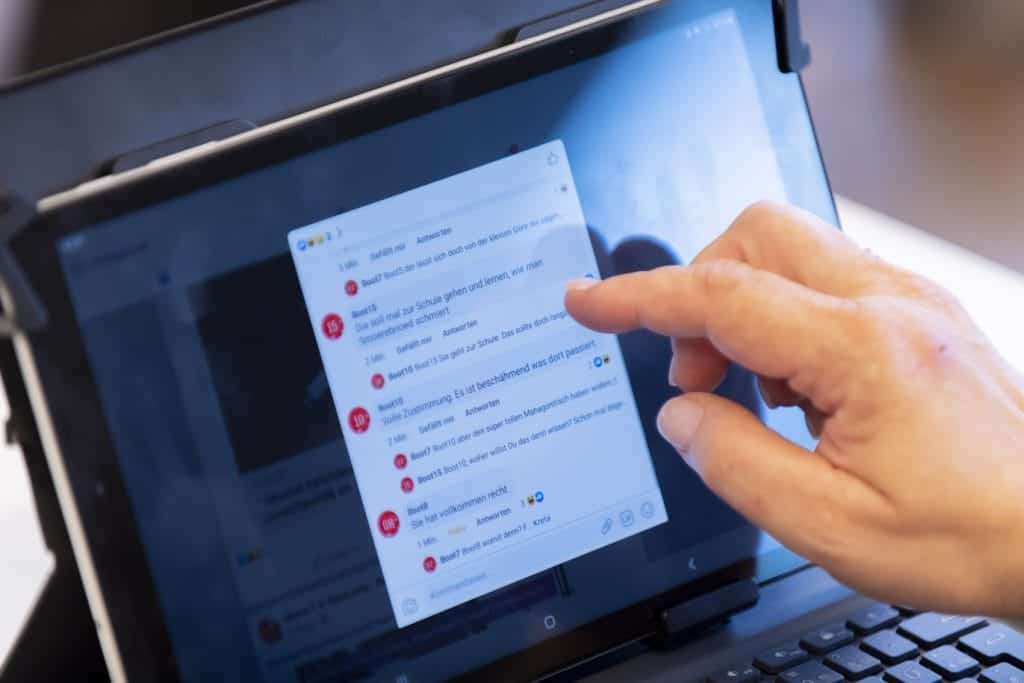
Lesezeit: 11 Minuten
Ausgabe 1/25 Faschismus
Medienpädagogin Julia Bauer ist Projektmanagerin für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit für den ichbinhier e.V., der sich aktiv für eine positive Debattenkultur und eine vielfältigere Meinungslandschaft in den sozialen Medien einsetzt.
Online-Hass: Ein zeitloses Phänomen mit neuer Dynamik
Wie sehr beeinflussen Medien unser Denken? Wer bestimmt, welche Stimmen gehört werden und was passiert, wenn Medien missbraucht werden? All das sind Fragen, die sich eine Gesellschaft mit Aufkommen eines neuen Massenmediums immer wieder stellen muss, egal ob es sich wie damals um das Kino, Radio oder Fernsehen handelte oder ob es heute um soziale Netzwerke geht. Dass Medien auch Hass und Hetze verbreiten ist keine Erfindung der sozialen Netzwerke, auch wenn diese das Phänomen durch eine besonders hohe Publikumsbeteiligung in ungeahnte Dimensionen gehoben haben. Geschichtlich betrachtet wurden „neue Medien“ stets auch dazu verwendet, politische Einflussnahme zu betreiben.
Während des Nationalsozialismus zum Beispiel wurde die öffentliche Meinung durch das damals neu aufkommende Massenmedium Radio systematisch kontrolliert. Bereits in den 1930er Jahren erkannten die Nationalsozialisten das immense Potenzial dieses Mediums, um ihre Propaganda effektiv zu verbreiten. Ab 1933 nutzten sie das Radio dann systematisch, um ihre Ideologien in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen und eine homogene, staatlich kontrollierte Sichtweise zu etablieren – und vor allem, um Angst und Schrecken zu verbreiten.1
Heute erleben wir in den sozialen Netzwerken eine ähnliche Entwicklung, die uns alle erschrecken sollte. Wir beobachten dabei vier konkrete Phänomene, die eine ungebremste, ja sogar exponentielle Verbreitung von Hass und Hetze ermöglichen: Zum einen wird Hass und Hetze bewusst von aggressiven Gruppen verteilt, die keinerlei Kosten noch Ressourcen scheuen. Welche Erfolge so erzielt werden können, zeigte sich eindrucksvoll während der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016. Laut einer Analyse des US-Geheimdienstausschusses im Kongress nutzten russische Trollfabriken Facebook, um etwa 80.000 Beiträge zu verbreiten. Ziel dieser Beiträge war es, politische Spannungen zu schüren, die öffentliche Meinung zu manipulieren und das Wahlergebnis zugunsten bestimmter Kandidaten zu beeinflussen.2
Die Algorithmen sind darauf ausgelegt, die Nutzenden möglichst lange auf der jeweiligen Plattform zu halten, um Werbeeinnahmen zu generieren. Emotional aufgeladene Inhalte, die Wut, Angst oder Empörung hervorrufen, erzielen hohe Interaktionsraten und werden von den Algorithmen bevorzugt und demnach breiter gestreut. Es handelt sich dabei auch um Beiträge, die Hass enthalten oder populistische Inhalte transportieren.3
Ein weiterer Mechanismus, der zur Verbreitung von Onlinehass indirekt beiträgt, ist das Fehlen wirksamer Regulierungsmaßnahmen von Seiten der Plattformbetreiber oder staatlicher Institutionen. Von einem differenzierten Kontrollsystem, wie es etwa bei der Selbstregulierung privater Medien in Deutschland etabliert ist, kann kaum die Rede sein. Hassrede und Desinformation bleiben daher häufig ungestraft und finden unkontrollierte Verbreitung. Die von der Plattform selbst als eindeutig rechtswidrig identifizierten Inhalte müssen in Eigenregie gemäß des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden, kom-plexere Fälle in bis zu sieben Tagen.4 Hier ist der Bedarf zur gesetzlichen Nachbesserung noch groß.
Ein vierter, nicht unwesentlicher Aspekt, ist die schiere Menge an Kommunikationsflüssen, die dadurch zustande kommt, dass jede:r in der Lage ist, Inhalte zu verbreiten. Inzwischen nutzen allein in Deutschland mehr als 50 Millionen Menschen soziale Medien.5 Dies ermöglicht auch die Verbreitung von Hass in bisher undenkbaren Dimensionen.
In die Kommentarspalten eingreifen, weil auch das Schweigen der Masse die Demokratie bedroht
Hass und Hetze sind Formen digitaler Gewalt und haben Folgen – individuelle, aber auch gesellschaftliche. Die Studie des „Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz“6 mit dem Titel „Lauter Hass – leiser Rückzug“ gibt Aufschluss darüber, wie sehr Hass den demokratischen Diskurs beschränkt. Fast die Hälfte der Befragten gab an, sich aufgrund von Online-Hass seltener zu politischen Diskussionen zu äußern oder ihre Meinung öffentlich zu vertreten. Besonders betroffen sind junge Frauen und Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund.
Diese Entwicklungen gefährden die Meinungsvielfalt im Internet in doppelter Hinsicht: Der „leise Rückzug“ von insbesondere Minderheitsmeinungen in den Kommentarspalten hat zur Folge, dass Hass, Desinformation und Intoleranz widerspruchslos stehen blieben. In diesem Klima aus Polarisierung, Verunsicherung und Abwertung werden sachliche Diskurse zunehmend unmöglich. Dabei wäre es falsch zu glauben, dass nur das Verhalten der Hater:innen zur Verbreitung von Hass beiträgt. Auch die schweigende Mehrheit – sprich die Mitlesenden – sind in gewisser Hinsicht mitverantwortlich. Denn ein Schweigen wird von Betroffenen nicht als neutrale Enthaltung gedeutet, sondern vielmehr als bewusste Duldung eines menschenverachtenden Verhaltens. Es wird folglich als aktive Zustimmung aufgefasst. Dieser Zusammenhang ist in der Kommunikationswissenschaft vielfach diskutiert und erforscht. Etwa durch Paul Watzlawicks Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“, indem er jede Form des Schweigens als eine kommunikative Handlung einordnet. Somit vermittelt auch das Schweigen Botschaften und trägt aktiv zum Verlauf von Gesprächen bei.7 Auch die in den 1970er Jahren von Elisabeth Noelle Neumann entwickelte Theorie der Schweigespirale macht deutlich, dass die Bereitschaft, sich öffentlich zur eigenen Meinung zu bekennen, stark von der Einschätzung des öffentlichen Meinungsklimas abhängig ist.8
#ichbinhier: Online-Aktionsgruppe, die für Respekt, Demokratie und Menschenrechte einsteht und Hass aktiv entgegenwirkt
Im Jahr 2016, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde und die Briten für den Brexit stimmten, eskalierte die Stimmung in den sozialen Netzwerken zunehmend. Diese Entwicklung beunruhigte Hannes Ley, den Gründer der Facebook-Gruppe #ichbinhier, zutiefst. Als er von der schwedischen Initiative #jagärhär erfuhr – einer Facebook-Gruppe mit 74.000 Mitgliedern, die Hassnachrichten mit Fakten, Empathie und sachlichen Antworten begegnen – lag die Lösung auf der Hand. In Absprache mit der Initiatorin der schwedischen Bewegung gründete er kurzerhand einen deutschen Ableger.
Die Aktionsgruppe entwickelte sich schnell zur größten Counterspeech-Initiative Deutschlands. Bereits nach zweieinhalb Jahren zählte sie über 45.000 Mitglieder und führt seither täglich organisierte Anti-Hate-speech-Aktionen durch. Die Arbeit der Gruppe erregte deutschlandweit Aufmerksamkeit, wurde vielfach ausgezeichnet und machte #ichbinhier zu einem der ersten bekannten Akteure im deutschsprachigen Raum, der sich erfolgreich gegen Hass im Netz einsetzt. 2017 folgte die Gründung des Vereins #ichbinhier, der die Facebook-Gruppe unterstützt und Bildungs- sowie Öffentlichkeitsarbeit vorantreibt.
Heute, acht Jahre nach ihrer Gründung, umfasst die Gruppe rund 40.000 Mitglieder. Noch immer setzen sich engagierte Nutzende tagtäglich dafür ein, durch sachliche, konstruktive und menschenfreundliche Kommentare auf Facebook den abwertenden und aggressiven Äußerungen entgegenzuwirken. Auch wenn sich die Herangehensweise der Gruppe im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, bleibt die Mission unverändert und ebenso relevant wie zu Beginn: Möglichst viele Menschen sollen dazu ermutigt werden, den digitalen Raum aktiv und respektvoll zu gestalten. Ziel ist es, mit möglichst vielen sachlichen und respektvollen Kommentaren die stillen Mitlesenden online zu erreichen und das digitale Klima wieder in Richtung Meinungsfreiheit zu lenken.
Dabei wird der Einsatz der Gruppe durch interne Erhebungen auch in Zahlen sichtbar gemacht. Allein zwischen Mai und November 2024 wurden in Kommentarspalten, die von Hass und Hetze geprägt waren, etwa 5.300 sachliche, konstruktive Kommentare verfasst und rund 39.000 unterstützende Reaktionen hinterlassen. Diese Zahlen verdeutlichen eindrucksvoll, wie stark die Initiative in den digitalen Dialog eingreift und eine positive Gegenstimme setzt.
Neben den Erfolgen auf Facebook hat #ichbinhier seine Aktivitäten auch auf andere Bereiche ausgeweitet. Der Verein setzt auf Bildungsarbeit, um über Mechanismen von Hatespeech, Desinformation und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufzuklären. Durch Workshops und Vorträge werden die neusten Strategien der digitalen Zivilcourage an diverse Zielgruppen – von Manager:innen über Kommunalpolitiker:innen bis hin zu Schüler:innen in Brennpunktschulen – vermittelt. Gleichzeitig betreibt #ichbinhier intensive Öffentlichkeitsarbeit, um die Thematik in die breite Gesellschaft zu tragen und die Bedeutung eines respektvollen Umgangs im Netz zu unterstreichen.
Wie geht digitale Zivilcourage? Vom simplen Klick bis zum gekonnten Faktencheck ist vieles dazwischen möglich
Der Online-Raum hat sich zu einem gleichwertigen Lebensraum entwickelt, in dem Menschen einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbringen. Vor diesem Hintergrund lässt sich das Eingreifen gegen digitale Gewalt als ein Akt digitaler Zivilcourage begreifen. Doch um wirksam intervenieren zu können, braucht es neben einer Portion Mut auch strategisches Wissen und digitale Kompetenzen, die erlernt werden können. Denn es geht in der digitalen Auseinandersetzung nicht darum, das Gegenüber mit einer Flut an Fakten zu „bekehren“ oder in endlosen Diskussionen zu besiegen. Schon gezielte, niedrigschwellige Interaktionen wie das Liken oder Speichern konstruktiver Kommentare können einen spürbaren Unterschied machen. Hier einige Tipps, wie wirkungsvolles Eingreifen besser gelingen kann:
Den Blick bewusst auf das Positive lenken
Statt sich direkt in Konflikte zu begeben, kann man den Betroffenen Unterstützung signalisieren, indem man positive Kommentare verfasst, die auf ihren Mut, ihre Stärke oder ihre Sichtweise eingehen. Ein Beispiel: „Danke, dass du deine Geschichte teilst. Deine Perspektive ist wichtig und wertvoll.“
Empathische Formulierungen wählen
Menschen, die angegriffen werden, profitieren oft schon von einer einfach formulierten Unterstützung. Ein simpler Kommentar wie „Ich stehe hinter dir“ oder „Du bist nicht allein“ kann eine große Wirkung entfalten.
Fakten bereitstellen, ohne belehren zu wollen
Oft kann man durch kurze, sachliche Richtigstellungen die Diskussion in eine neue Richtung lenken.
Kreatives teilen
Wer nicht gerne schreibt, kann auch mit Emojis oder ermutigenden Memes Zeichen setzen.
Algorithmen durch Klicks aktivieren
Wer keine Zeit und/oder wenig Erfahrung hat, kann zur aktiven Verbreitung von positiven Kommentaren oder Beiträgen beitragen, indem er mit Beiträgen umfassend interagiert, sie also liked, speichert, teilt, versendet oder (falls technisch erlaubt) erneut veröffentlicht.
Angesichts der aktuellen Weltlage, in der Demokratien massiv unter Druck geraten, der Ton im Netz immer extremer wird und sich viele Menschen aus Angst vor Anfeindungen zurückziehen, braucht es weiterhin mutige und zugleich strategisch handelnde Stimmen, welche sich für Menschlichkeit und Respekt starkmachen. Der ichbinhier e.V. möchte dazu beitragen, dieses Wissen und diese Haltung möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen – über Bildungsangebote ebenso wie über unsere vielfältigen Social-Media-Präsenzen.
#ichbinhier goes Future: Es sind weiterhin mutige und strategisch handelnde Stimmen für Menschlichkeit und Respekt nötig
Das Herzstück unserer Arbeit bildet dabei weiterhin unsere Facebook-Gruppe – unser größtes und vielfältigstes Angebot zum Thema digitale Zivilcourage. Tagtäglich setzen sich unsere Mitglieder dort aktiv gegen Hass und Hetze ein. Um sie dabei zu unterstützen und zu befähigen, stellen wir ihnen hilfreiche Werkzeuge wie Guidelines, Workshops und Werkstattformate zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl an Aktionsformaten an, welche es den Mitgliedern ermöglichen, gemeinsam wirkungsvoll Hasskommentare zu verdrängen und Betroffenen Solidarität zu zeigen.
Ein Beispiel ist die „Artikelbörse“: Hier werden täglich Links zu Medien-artikeln geteilt, deren Kommentarspalten eskaliert sind. Wer gerade Zeit hat, kann die Beiträge besuchen und mit positiven, solidarischen Kommentaren dazu beitragen, die Diskussionskultur zu verbessern. Ergänzt wird dieses Engagement durch Formate, die den Zusammenhalt in der Gruppe stärken, welche Motivation schenken und das Gemeinschaftsgefühl der ichbinhieros – unserer Mitglieder – festigen. Genau dieses Gefühl, Teil einer größeren Bewegung zu sein und gemeinsam einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, treibt viele unserer Engagierten täglich an.
Sowohl Verein als auch Mitgliedern ist wohl bewusst, dass Hass und Hetze längst nicht mehr nur auf einzelne Plattformen wie Facebook beschränkt sind, sondern das gesamte digitale Umfeld durchziehen. Ob auf TikTok, wo Videos mit extremen Aussagen binnen Minuten Millionen Menschen erreichen, auf Twitter, wo der Plattformbesitzer Elon Musk selbst massiv Desinformationen verbreitet,9 oder auf Plattformen wie Instagram, YouTube oder gar LinkedIn – Hasskommentare sind überall präsent.
Um auch auf diesen Plattformen den negativen Kräften nicht das Feld zu überlassen, setzen wir auf Menschen, die aktiv mithelfen: Ehrenamtliche, die mit inspirierenden Inhalten die Online-Diskurse positiv prägen, Expert:innen, die den Ausbau unseres Engagements auf weiteren Plattformen vorantreiben, Mutmachende und Unterstützende, die die Menschen motivieren und wichtige Impulse liefern sowie natürlich Spendende, denn ohne finanzielle Ressourcen wäre und ist unsere Arbeit nicht möglich. Nur gemeinsam können wir die Demokratie digital stärken und eine Welt gestalten, in der Respekt und Menschlichkeit den Ton angeben.
Du hast Interesse am Thema „Faschismus“?
Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 1/25 Faschismus.
Titelbild: Einsatz von #ichbinhier-Ehrenamtlichen (Foto: Ich bin hier e.V.)
Literatur
- 1 Hasselbach, Christoph (2023): Vor 90 Jahren: Nazi-Propaganda mit dem Volksempfänger. www.dw.com/de/vor-90-jahren-der-volksempf%C3%A4nger-als-instrument-der-nazi-propaganda/a-66540196
- 2 Schuler. Marcus (2019): Bis zu 126 Millionen Nutzer sahen Russland-Anzeigen: www.tagesschau.de/ausland/facebook-russland-posts-101.html
- 3 Milli, Smitha; Carroll, Micah; Wang, Yike; Pandey, Sashrika; Zhao, Sebastian; Dragan, Anca D. (Hrsg.) (2023): Engagement, User Satisfaction, and the Amplification of Divisive Content on Social Media. California. arxiv.org/pdf/2305.16941
- 4 Bundesministerium für Justiz (2017): Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken.www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html
- 5 Bitkom e.V. (2023): Mehr als 50 Millionen Deutsche nutzen soziale Medien. www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Mehr-als-50-Millionen-Deutsche-nutzen-soziale-Medien
- 6 Das NETTZ, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid und Neue deutsche Medienmacher*innen als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz (Hrsg.) (2024): Lauter Hass – leiser Rückzug. Wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. Berlin. kompetenznetzwerk-hass-imnetz.de/download_lauterhass.php
- 7 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson; Don D. (1969): Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien. Verlag Hans Huber, Bern/Stuttgart/Wien.
- 8 Noelle-Neumann, Elisabeth (1980): Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut. München/Zürich: Piper.
- 9 Center for Countering Digital Hate (Hrsg.) (2024): Musk misleading election claims viewed 1.2bn times on X – with no fact checks. Elon Musk is spreading harmful election disinformation on X, breaking his platform’s own guidelines. USA. counterhate.com/research/musk-misleading-election-claims-viewed-1-2bn-times-on-x-with-no-fact-checks/

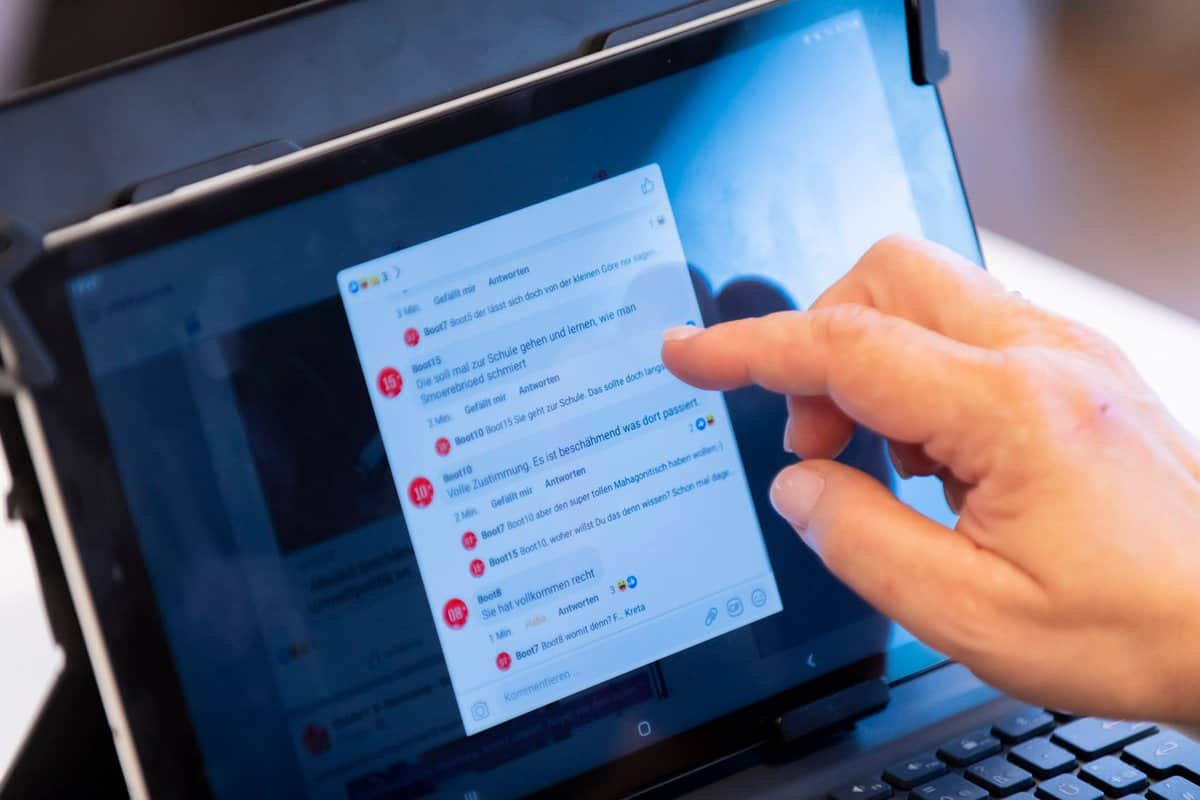
Rückmeldungen