Jugendarbeit und Schule – zwei Seiten einer Medaille?

Lesezeit: 34 Minuten
Ausgabe 2/23 Jugendarbeit und Schule
Drei Perspektiven – drei Gespräche:
… mit Michael Renner, ehemaliger Gymnasial-Schulleiter und Mitglied der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
… mit Susanne Keuchel, Vorsitzende der Bundesvereinigung kulturelle
Kinder- und Jugendbildung und ehemalige Präsidentin des Deutschen Kulturrats und
… mit Thomas Rauschenbach, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Direktor
des Deutschen Jugendinstituts e.V. in München sowie Uwe Schulz, Referatsleiter
Ganztagsbildung im Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht
und Integration in Nordrhein-Westfalen.
Die Schule
Ein Gespräch mit Michael Renner, ehemaliger Schulleiter am Gymnasium in Immenstadt und Mitglied der Landessynode über das, was sich Schule von Jugendarbeit wünscht.

baugerüst: Wie haben Sie Schule in den letzten Jahren erlebt und wie wird sie sich weiterentwickeln?
Renner: Zunächst mal muss man Schule differenzieren in Grundschule und dann, je nach Leistungsfähigkeit, in Mittelschule, Realschule oder Gymnasium. Ich finde dieses System inzwischen nicht mehr zielführend, wenn nach der vierten Klasse die Noten entscheiden, wie es für ein Kind weitergeht. In Norwegen gibt es beispielsweise im Sport bis zum zwölften Lebensjahr keinen Leistungsgedanken. Bei Wettbewerben bekommen alle am Ende dieselbe Plakette. Die Kinder sollen erst einmal einfach nur Spaß am Sport haben. Kürzlich war ich mit meinem Enkel bei einem Fußballturnier, da kämpfen schon die ganz Kleinen mit vier und fünf Jahren um die Plätze. Da frage ich mich schon: Welchen Sinn hat das? Das kann man auf Schule übertragen. Ich wünsche mir eine Schule, in der die Kinder länger beisammen bleiben, ähnlich wie in der Schweiz, wo weiterführende Schule oft erst mit der achten Klasse beginnt. Da sind die Entscheidungen für eine bestimmte Schulart viel bewusster und motivierter. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Zusammenhalt unter den Kindern und Jugendlichen. Wir trennen einfach zu früh.
baugerüst: Glauben Sie, das könnte sich in der Zukunft in Bayern ändern?
Renner: Ich hoffe es. Bayern macht ja einerseits mit der Leistungseinteilung gute Erfahrungen und schreibt sich auf die Fahne, sehr wenige Studienabbrecher zu haben. Andererseits glaube ich persönlich, es bleiben viele gute Leute und „Persönlichkeiten“ dadurch auf der Strecke. Gerade in der Pubertät sind Jugendliche mehr mit sich selbst als mit der Schule beschäftigt. Ein anderes Schulsystem, in dem man länger zusammenbleibt und zum Beispiel nur Kurse wiederholt werden, aber nicht ganze Jahrgangsstufen, würde da sicherlich helfen.
baugerüst: Derzeit ist Schule ja vor allem dabei, Corona-Defizite auszubügeln. Für non-formale Bildung bleibt da wenig Raum, oder?
Renner: Meiner Erfahrung nach betrifft das nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch die Erwachsenen. Es brechen ja auch Lehrkräfte durch Corona weg. Ich kenne einige Fälle, wo Lehrkräfte an den Folgen einer COVID-Infektion so massiv erkrankt sind, dass sie ihren Dienst nicht mehr ausüben können. Dasselbe hat man auch bei den Schüler:innen. Fatal ist, dass das während der Corona-Zeit gar nicht so auffiel, sondern erst jetzt im Nachhinein vermehrt gravierende Fälle auftreten. Die Kinderpsychiatrien haben Wartezeiten zwischen sechs und neun Monaten. Das finde ich wirklich besorgniserregend, weil schnelle Hilfe erforderlich ist. Das trifft ja auch Schüler:innen, die vorher (sehr) gut in der Schule waren. Die haben zum Teil ihre Lebens- und Leistungsmotivation verloren.
baugerüst: Woran liegt das? Ist Schule stressiger geworden?
Renner: Unsere Schule war während Corona digital sehr gut unterwegs, wir konnten nahtlos umschalten, weil wir schon vorher mit Teams gearbeitet haben. Aber wenn dann die Schüler:innen die Freiheit haben, ob sie im Unterricht mitmachen wollen oder nicht, oder auch wenn das WLAN nicht stabil funktioniert, dann hilft das auch nichts. Es gibt bei uns im Allgäu einfach noch Orte, die haben bis heute kein stabiles Netz. Bei mir zuhause ist das zum Beispiel auch so. Und wenn zwei Erwachsene und drei Kinder zu Hause online während Corona arbeiten sollten, dann hat das WLAN das einfach nicht gepackt. Da haben einige das Lernen verlernt. Zum Beispiel einer unserer Abiturienten, der im Januar nicht mehr zum Abitur antreten, sondern stattdessen ein Startup gründen wollte. Völlig ohne Not, denn er war ein ordentlicher Schüler. Seine Mutter hat uns dann erklärt, dass er während Corona aus dem Schulsystem „regelrecht weggebrochen“ ist. Wenn er nicht gute Freunde gehabt hätte, die ihn in der Schule gehalten haben, wäre er schon früher gegangen. Gottseidank hat er es sich kurz vor den Faschingsferien noch einmal anders überlegt. Aber wir alle haben lange versucht, ihn zu überzeugen, nicht alles wegzuwerfen. Wir dachten zu lange, wenn Corona vorbei ist, läuft alles ganz normal weiter. Das war ein Trugschluss.
baugerüst: Wie war es mit den non-formalen Angeboten an Ihrer Schule während Corona?
Renner: Mit Teams konnten wir zumindest ganz normal Unterricht machen, das hat ab Ostern 2020 wirklich sehr gut geklappt. Auch während des Wechselunterrichts. Aber wir haben auch gemerkt, dass durch den fehlenden direkten, körpersprachlichen Kontakt die Beziehungsebene verlorengeht. Die aber ist ein ganz entscheidender Faktor für Lernmotivation und gelingenden Unterricht. Außerdem ist der Unterricht ja nur das eine. Das andere ist die gemeinsame schulische Zeit mit den Freunden. Ich habe das in der Sommerschule 2021 gelernt. Wir dachten, wir müssen den Schüler:innen den Tag komplett mit Lernen und Freizeitangeboten von 9 bis 15 Uhr durchstrukturieren, aber die wollten den Nachmittag frei gestalten und einfach zusammen chillen. Gemeinsame Schulwege, Arbeitsgemeinschaften, Pausen, das gab es ja alles nicht mehr. Unser Gymnasium hat einen großen Einzugsbereich, da haben sich Freund:innen über Monate nicht mehr getroffen und festgestellt, dass der Chatroom kein Ersatz für
direkte Begegnungen ist.
baugerüst: Wie könnte sich evangelische Jugendarbeit in so ein Schulsystem einbringen auch mit Fokus auf den ländlichen Bereich?
Renner: Ich bin total begeistert von dem Coburger Modell, das ich als Synodaler vor Jahren erleben durfte. Die Evangelische Jugend macht (Anm.d.Red: Siehe auch S. 55) dort für mehrere Schulen die Ganztagsangebote und kann mit den dadurch erzielten finanziellen Mitteln eine professionelle, gute und nachhaltige Struktur aufbauen. Wir haben an der Schule nur eine Offene Ganztagsgruppe, die ein Diplom-Sportlehrer wirklich gut macht. Aber von nur einer Gruppe kann er kaum leben, die ist nicht ausfinanziert. Die Coburger haben da viel mehr Möglichkeiten, können sich bei Krankheit gegenseitig aushelfen, es gibt weniger Fluktuation, die Betreuer bleiben über Jahre dieselben. So lassen sich auch Schüler:innen leichter als Teamer gewinnen, man holt oft sogar Schüler:innen ab, denen man das nicht zugetraut hätte. Das würde ich mir auch für unsere Schule wünschen. Die Evangelische Jugend hat einfach ein verlässliches Profil, da kannst du als Schulleiter froh sein, wenn sie so ein Angebot für dich macht. Auf dem Markt tummeln sich genug Anbieter, die Betreuung nur wegen des Geldes machen. Das müsste nicht sein, denn die Schüler:innen im Offenen Ganztag haben professionelle Betreuung verdient und die kostet Geld. Auch in der Schulsozialarbeit und der Schulseelsorge könnte die EJ mannigfaltige gute und sinnvolle Angebote machen.
Ich selbst bin im CVJM Kempten in den 70er und 80er Jahren groß geworden. Wir waren damals viele Jugendleiter:innen, heute sind es in Kempten viel weniger und auch in Immenstadt, wo die Schule liegt, gibt es kaum noch evangelische Jugendarbeit. Das heißt, bei uns sind die Strukturen für eine EJ Arbeit, wie vorhin geschildert, gar nicht da. Aus meiner Tätigkeit in der Landessynode weiß ich aber, dass das in anderen bayerischen Regionen ganz anders aussieht. Dort ist die Evangelische Jugend noch stark vertreten, wie eben in Coburg. Ich würde der Evangelischen Jugend gerne Mut machen, da aktiver zu werden. Es ist nach wie vor einfach, über eine gute Jugendarbeit Zugang zu Kindern und Jugendlichen zu finden. Die meisten Schulleitungen würden eine Kooperation sicherlich unterstützen. Wie gesagt, wenn die Struktur im Allgäu anders wäre, dann wäre die EJ mein Favorit für die Nachmittagsbetreuung.
baugerüst: Wird sich etwas durch den Ganztagsanspruch ändern? Sie haben gesagt, der Ganztag wird derzeit von Schüler:innen mit hohem Betreuungsbedarf genutzt – wäre es nicht schön, wenn Eltern ihre Kinder gern in den Ganztag schicken?
Renner: Da kann ich nur für meine Schule sprechen. Unser altes Schulgebäude ist dafür gar nicht ausgelegt. Im Gegensatz zu beispielsweise Finnland oder Schweden gibt es bei uns keine schöne Mensa, einladenden Rückzugsmöglichkeiten, frei zugänglichen Computerarbeitsplätze oder einladenden Außenanlagen. Das ist ein Funktionsbau aus den 70ern und in den letzten Jahren ist aus Brandschutzgründen alles, was heimelig war, rausgeflogen, auch eine volleingerichtete schöne Mensa. Nun versuchen wir schon seit längerem wieder einen schönen Mittagsraum mit Mikrowelle und ähnlichem einzurichten. Das scheitert immer wieder am Brandschutz. Die Politik (und die Kirche) hat immer wieder eigentlich gute neue Ideen, doch denkt sie die nicht bis zum Ende durch. Wenn ich Beschlüsse fasse, dann muss ich zu einer guten Umsetzung auch das nötige Geld bereitstellen.
Die Rahmenbedingungen stimmen oft einfach nicht. Und das hängt
allein von den finanziellen Mitteln des Sachaufwandsträgers ab, also meist von der Finanzkraft einer Stadt oder eines Landkreises. Hat man viel Geld, kann man sich ein tolles Schulgebäude mit allem Drum und Dran leisten. Hat man zu wenig, dann eben nicht. Damit entscheidet der Wohnort darüber, ob ein Schüler oder eine Schülerin ein ansprechendes, einladendes Schulgebäude hat oder nicht. Ich finde, unsere Schülerinnen und Schüler sind unser wertvollstes Gut, sie sind unsere Zukunft. Das dürfte nicht sein!
Wenn ich mir ansehe, was unsere Schulpartnerfirmen, zum Beispiel Bosch, ihren Arbeitern und Angestellten bieten, komme ich schon ins Grübeln. Die haben einen Fitnessraum, Lounges zum Zurückziehen, ansprechende Arbeitsstätten und wirklich schöne Kaffee- und Essensräume, von so etwas können wir nicht nur im Offenen Ganztag nur träumen. Die Firmen lassen es sich etwas kosten. Sie wollen, dass die Leute bei ihnen bleiben und sich wohlfühlen. Im Schulbereich fängt es doch schon bei der Beförderung an. Mal überspitzt formuliert: Jede Legehenne hat mehr Platz als die Kinder im Schulbus. In anderen Ländern werden sie vor der Haustür abgeholt und bei uns pfercht man sie zusammen. So etwas kann eigentlich nicht sein! In Bildung wird nach wie vor zu wenig Geld gesteckt.
baugerüst: Wie kann Schule noch von Jugendarbeit profitieren?
Renner: Jugendarbeit prägt junge Menschen massiv. In der Schule merkt man gleich, wer aus der Jugendarbeit kommt, sowohl unter den Schüler:innen als auch im Kolle-
gium. Das sind normalerweise die, die nah an der Lebenswirklichkeit von Kindern dran sind und meist hoch engagiert. Das sind tolle Pädagogen, die nicht nur dem elitären Leistungsanspruch folgen, sondern das Kind auch als Persönlichkeit sehen.
Mich hat auch die Jugendarbeit geprägt und ich habe damit sehr gute Erfahrungen während meiner Dienstzeit in Füssen gemacht. Alle zwei Jahre bot ich für die EJ Füssen eine schulübergreifende Ferienfreizeit in der Tarnschlucht in Frankreich an. Heute noch sprechen mich ehemalige Schüler:innen an, ob ich das nicht jetzt im Ruhestand wieder anbieten könnte, das sei für sie eine tolle und prägende Erfahrung gewesen. Das hat auch viel fürs Schulklima gebracht. Du kanntest die Schüler:innen aus ganz anderen Zusammenhängen. Viele Freizeitleiter: innen haben sich dann auch in der schulischen SMV-Arbeit engagiert. Und auch die Eltern waren froh über ein zweiwöchiges Ferienangebot und weil es ein kirchliches war, wussten sie, dass sie Vertrauen haben können. Ich würde gerne noch mehr Lehrer:innen gewinnen wollen, die aus der Jugendarbeit kommen und schulisch etwas auf die Beine stellen. Viele meiner Synoden-Kolleginnen und Kollegen kommen aus der Jugendarbeit. Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrkräfte … die Evangelische Jugend ist einfach eine tolle Lebensschule.
Heute buhlen ja alle um die gleichen Jugendlichen: Feuerwehr, Musikschule, Sportverein, aber es werden immer weniger Jugendliche mit immer weniger Zeit. Es ist so wichtig, die Kinder früh gut zu prägen. Die Nachwuchsgewinnung beginnt nicht erst an der Uni, sondern schon viel früher. Im Religionsunterricht und in den Angeboten, die Kirche an Schulen macht. Und jede(r) vernünftige Schulleiter:in fördert solche Angebote, weil sie/er weiß, dass das der Schule etwas bringt. Schade, dass es manchmal noch so viele Berührungsängste zwischen Schule und Jugendarbeit gibt.
baugerüst: Vielen Dank.
Die Schüler:innen
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Susanne Keuchel, Vorsitzende der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung und ehemalige Präsidentin des Deutschen Kulturrats über die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im non-formalen Bildungsbereich.

baugerüst: Was sagen Sie: Ist Jugendarbeit an Schulen nötig oder nicht? Warum?
Keuchel: Ich weigere mich mittlerweile von außerunterrichtlichen Angeboten an Schulen zu sprechen, ich bevorzuge hier den Begriff Ganztag. Wir kommen aus einem Bildungssystem, das traditionell das Formale in den Vormittag legt und das Non-formale in den Nachmittag. Das ist ja nicht in allen Ländern so, andere Länder bieten, auch im Sinne der Chancengleichheit, bereits einen Ganztag für alle an. Darum würde ich nicht sagen, Jugendarbeit gehört in die Schule, sondern in einen Ganztag gehören formale und non-formale Angebote.
baugerüst: Das setzt allerdings voraus, dass der Ganztag überall gut angenommen wird.
Keuchel: Hier sollte nicht die Nachfrage das Angebot bestimmen, sondern das Angebot die Nachfrage. Ich glaube, dass wir einen großen Nachholbedarf haben, was die Gestaltung des Ganztags angeht. Der Ganztag sollte eigentlich so sein, dass alle ihre Kinder gerne dort hinschicken, auch wenn sie nicht unbedingt auf die Betreuung angewiesen sind. Ich wünsche mir, dass wir zum Beispiel mit kultureller Jugendarbeit alle Kinder erreichen. Wir wissen, dass wir in diesem auf den Nachmittag fixierten System an Grenzen stoßen, vor allem bei jüngeren Kindern. Wir sind sehr auf die Mitwirkung der Eltern angewiesen, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir haben parallel zu PISA einige empirische Studien erarbeitet, an zweien war ich selbst beteiligt, die gezeigt haben, dass junge Menschen aus Elternhäusern mit formal niedrigen Schulabschlüssen an unseren Angeboten kaum partizipieren. Daher kooperieren wir in der kulturellen Bildung schon lange mit Schulen. Es gibt einzelne, sehr gelungene Modelle, aber grundsätzlich ist es im derzeitigen System schwierig, qualitativ hochwertige non-formale Bildung in Schule zu etablieren.
Mein Wunsch ist, dass es ein System gibt, in das verschiedene Anbieter non-formale Angebote einbringen können, um alle Kinder zu erreichen. Ich habe selbst drei Kinder, ich war mein Leben lang berufstätig, das war ein wahnsinniger Spagat. Durch den Fachkräftemangel rückt das jetzt ins Bewusstsein, dass man ein gutes System hinkriegen muss, das Kindern und Eltern nutzt. In den Vereinigten Staaten gibt es durch den Campus-Gedanken eine gute Praxis. In diesen Schulen können alle Kinder und Jugendlichen diverse Freizeitaktivitäten, verschiedene kulturelle Angebote oder auch Sportarten ausüben. Das wird völlig losgelöst von den Eltern ermöglicht. Jeder kann den Tag nach seinen Interessen gestalten, alles greift ineinander über. Speziell der Campusgedanke könnte in Deutschland vor allem auch für den ländlichen Bereich spannend sein. In Brandenburg gibt es schon tolle Ideen. Dort nutzt man die Entwicklung im Ganztag schon, um kulturelle Begegnungsorte zu schaffen. Im urbanen Bereich ist das oft nicht möglich, aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten.
Finnland ist auch ein sehr spannender Orientierungsort für mich, ich bin in einem kulturellen, europäischen Netzwerk tätig. Da könnte man einiges übertragen. Dort wird vieles nicht von der Schule organisiert, sondern von der Kommune. Es gibt zum Beispiel ein kulturelles Curriculum, das heißt, die Städte bekommen Unterstützung vom Staat, wenn sie sich an dem Programm beteiligen und klären, welche Angebote es vor Ort gibt. Dann überlegen die Städte, was für wen spannend sein könnte und legen zum Beispiel fest: Alle Kinder, die drei Jahre alt sind, besuchen das Puppentheater. Dann hängt es nicht mehr vom Lehrer ab, ob er etwas anbietet oder von Eltern, die über spannende Angebote erst einmal informiert werden müssten, sondern das ist durch das kommunale Steuerungsprinzip verbindlich geregelt. So können non-formale Anbieter mit Schule zusammenkommen, ohne die Angebote mit einer einzelnen Schule auszuhandeln.
Ein anderes Beispiel aus Finnland ist das Programm „Jedem Kind ein Hobby“. Das ist für mich Jugendarbeit! Jedes Kind wird gefragt, welches persönliche Hobby es im Ganztag ausüben möchte, diese Umfrage wird ausgewertet und dann wird die Infrastruktur entsprechend gestellt.
baugerüst: Das heißt, es findet viel in den Räumlichkeiten statt, aber die Schule ist nicht für alles selbst verantwortlich, sondern hat Partner, zum Beispiel in der Kommune?
Keuchel: Der Ganztag geht hier stark in eine gebietsräumliche Verantwortlichkeit. Das wäre natürlich sehr gut übertragbar. Ich nehme als Beispiel die Musikschule. Wir haben nicht unendlich viele Musikschulen. Und nicht alle Kinder interessieren sich für Musik. Eine Musikschule könnte für mehrere Schulen zuständig sein und zum Beispiel immer in der ersten oder zweiten Klasse verpflichtend ein Instrumenten-Karussell anbieten. Alle, die ein Instrument interessiert, können dann weitermachen. Im besten Falle kann man dann Unterricht rhythmisiert anbieten, so dass der Musiklehrer erst morgens in die eine Schule kommt, an der sich zehn Kinder für ein Instrument interessieren, danach in die andere Schule, in der es 15 Kinder sind. Das könnte man sehr gut kommunal steuern. Wir denken immer noch: Da ist eine Schule und diese muss ein Angebot machen und Impulse geben. In einem kommunalen Steuerungsmodell wäre es so, dass formale und non-formale Anbieter gemeinsam, moderiert von der Kommune, überlegen, wie sie den Ganztag bestmöglich gestalten.
baugerüst: Wo könnte da eine kirchliche Jugendarbeit ihren Platz finden?
Keuchel: Ich glaube, dass es da ganz viele unterschiedliche Modelle gibt, beispielsweise die Pfadfinder oder einfach offene Räume zur Begegnung. Da gibt es keine Universallösung, dazu sind die Ressourcen und Strukturen in den Gebieten zu unterschiedlich. Es gibt sehr schöne Modelle, die einen erweiterten Sozialraum in Betracht ziehen, zum Beispiel durch ein Jugendzentrum in unmittelbarer Nähe einiger Schulen. Es muss ja nicht alles in der Schule selbst stattfinden. Auch im Grundschulbereich kann das schon möglich sein, trotz der Betreuungs-Notwendigkeit. Wir müssen ja auch realistisch sehen, dass oft gar keine Möglichkeit ist, noch anzubauen und in der Schule selbst gute Räume zu schaffen. Dafür sind erweiterte Sozialraum-Modelle spannende Momente, die auch förderfähig sind. Aber das setzt erst einmal ein Umdenken voraus.
baugerüst: Was könnten Inhalte sein? Was brauchen Kinder und Jugend-liche neben Mathe, Deutsch und Englisch für ihre Entwicklung?
Keuchel: Um zu wissen, wie individuell das ist, müssen wir nur in unsere eigenen Biografien schauen. Kinder brauchen geschützte Frei- und Experimentierräume, wo sie ihre eigenen Geschichten spinnen, mit den eigenen Freunden spielen können. Wo sie jenseits von Schule Impulse bekommen und Beziehungen aufbauen können, die prägender sein können, als im Klassenverband. Mit Gleichaltrigen, aber auch mit erwachsenen Vorbildern jenseits des Elternhauses und von Lehrern. Wenn ich an meine Hobbies denke, die ich bis heute pflege und wertschätze, die habe ich alle im non-formalen Bildungskontexten kennengelernt. Ich bin Musikwissenschaftlerin geworden, aber mein Wissen habe ich nicht aus dem Musikunterricht.
baugerüst: Könnte Schule der Schlüssel sein, weil man wirklich alle Kinder erreicht?
Keuchel: Lassen Sie uns doch von Ganztag sprechen. Es geht um eine Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendlichen in einer Gesellschaft, die vor vielen Herausforderungen steht. Und es geht darum, diese Verantwortung den ganzen Tag zu übernehmen, um für Kinder und Jugendliche eine gute Struktur zu schaffen.
baugerüst: Das klingt nach einer Reform, die viel weiter geht als das, was bisher geplant ist.
Keuchel: Das macht mir auch ein bisschen Sorgen, denn ich glaube, wir müssen aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen und auch aus der Elternperspektive heraus denken. Wir haben in vielen Teilen derzeit eine Reparaturgesellschaft. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für alle Kinder, viele werden abgehängt und da müssen wir uns doch fragen: Warum? Und es bringt doch nichts, ein Bildungsangebot für Bildungsbenachteiligte zu machen, das ist doch auch eine Stigmatisierung. Gute Angebote müssten für alle zugänglich sein, egal, wo man herkommt.
baugerüst: Wenn Sie ein Bild zeichnen könnten: Was passiert, wenn das Kind morgens in die Schule kommt?
Keuchel: Das Kind kommt in die Schule und es gibt erst mal einen Raum, in dem auch gefrühstückt werden kann. Nicht muss, aber kann. Auf jeden Fall bevorzuge ich eine offene Anfangsstruktur, denn es gibt viele Kinder und Jugendliche, die zu Hause kein Frühstück bekommen. Und durch die Option gibt es dann keine Stigmatisierung. In Finnland gibt es auch Küchennischen, in denen die Kinder sich ihr Frühstück selbst machen können. Das ist ja auch schon wieder non-formale Bildung. Eine Rhythmisierung fände ich auch wunderbar und eine interdisziplinäre Vernetzung der
Unterrichtseinheiten. Natürlich muss auch fachspezifisches Wissen vermittelt werden, aber es muss genügend Freiräume geben für eigene Interessen, zum Spielen und Zurückziehen, aber auch Anregungsangebote, die frei gewählt werden können. Da muss es dann natürlich Impulse geben, damit ich selbst prüfen kann, ob ich ein Angebot wählen möchte. Wenn ich als Junge nie einen männlichen Tänzer gesehen habe, dann wähle ich sicher nicht Tanzen. Das ist für mich auch Chancengerechtigkeit.
Wichtig wäre auch eine gute Raumgestaltung, es müssen auch Rückzugsmomente gegeben sein, sonst kann ich ja nie lesen, oder mit einer Freundin plaudern oder einfach Tagträumen. Ich komme aus einer anderen Generation, da waren die Kinder schon mit drei Jahren alleine draußen zum Spielen. Ich finde es wichtig, dass über ein Gebäude hinaus Erlebnismomente gegeben sind.
baugerüst: Das klingt, als bräuchten wir für diesen Traum unglaublich viele Fachkräfte. Welche Modelle können Sie sich da vorstellen? Reicht schon eine JuLeiCa als Qualifikation, um pädagogisch am Ganztag beteiligt zu sein?
Keuchel: Das ist eine Frage der Rahmenbedingungen. Wir haben im non-formalen Bereich eine wunderbare Struktur. Da sind schon ganz viele Fachkräfte. Wenn non-formale Bildung wirklich im Ganztag praktiziert würde, dann wäre ein großer Teil des Problems gelöst. Das ist Zukunftsmusik und würde ein großes Maß an Organisation erfordern. Aber auch da könnten kommunale Steuerungs-elemente helfen. Ich könnte mir zum Beispiel einen kommunalen Ganztags-Rat vorstellen, der von Sport über Kultur bis Kirche gemeinsam mit den Schulleitungen, dem Kinderrat und Elternvertretern überlegt, welche Angebote man machen könnte und die Ressourcen entsprechend bereitstellt. Zur Zeit gilt die Vorstellung, dass wir für den Ganztag viele zusätzliche Fachkräfte brauchen, weil wir nicht von einem synergetischen Zusammenwachsen beider Bereiche ausgehen. Ehrenamt ist dabei natürlich immer eine Bereicherung, vor allem auch im Beziehungskontext. Aber es bedarf hier immer auch einer Begleitung von hauptamtlich pädagogisch Qualifizierten.
baugerüst: Vielen Dank.
Die Jugendarbeit
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und Direktor des Deutschen Jugendinstituts e.V. in München, und Uwe Schulz, Referatsleiter Ganztagsbildung im Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration in Nordrhein-Westfalen, über die Chancen und Risiken von Jugendarbeit an Schulen und die Veränderungen durch den Ganztagsanspruch.
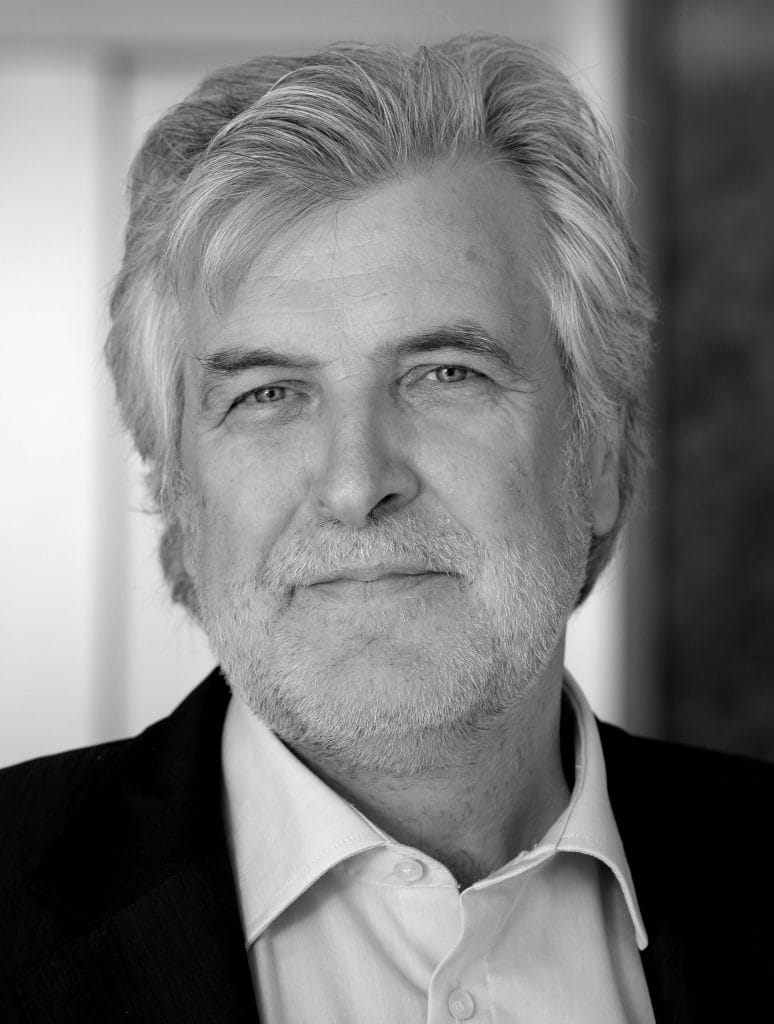

baugerüst: Sie beide haben sehr viel Erfahrung, wenn es um das Thema „Bildung“ geht. Sie haben dutzende Fachartikel publiziert, sind in Gremien mit dem Thema befasst und setzen sich hauptberuflich dafür ein. Welche Meinung haben Sie grundsätzlich zu kirchlicher Jugendarbeit an Schulen? Warum ist sie wichtig – oder auch nicht und was sind Ihrer Meinung nach Ihre Aufgaben?
Rauschenbach: Sie steigen aber gleich steil und anspruchsvoll ein. Der erste Schritt wäre für mich zunächst die Frage: Warum braucht es überhaupt Jugendarbeit an der Schule? Etwas pauschal formuliert sind Schule und Jugendarbeit zwei Seiten der gleichen Medaille. Bei beiden geht es um Kinder und Jugendliche, um ihre Entwicklung, geht es um die Rahmenbedingungen ihres Aufwachsens, um die Frage, wie man Heranwachsende fördern und unterstützen kann, wie man sie in diesem Prozess begleiten kann auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Dennoch ist selbstverständlich der formale Rahmen von Schule und Jugendarbeit sehr unterschiedlich: Selbstorganisation, Beteiligungsorientierung, Freiwilligkeit, kein Unterricht, keine Prüfungen, kein Sitzenbleiben. Das alles kennzeichnet Jugendarbeit im Unterschied zur Schule. Interessanterweise ist der Ruf nach mehr Jugendarbeit, mehr Jugendsozialarbeit, mehr Schulsozialarbeit oft von Seiten der Kultusministerien ausgegangen. Diese Erwartungen waren geprägt von der Einsicht, dass die heutige Schule mit den Bildungs- und Entwicklungsaufgaben der Kinder und Jugendlichen alleine nicht mehr klarkommt. Deshalb steht mehr denn je die Frage im Raum: Könnte die außerschulische Bildungsarbeit, die Kinder- und Jugendhilfe, nicht ein Partner sein, der ergänzende Elemente und Kompetenzen ins Schulleben einbringt, die ihrerseits für das Gesamtunternehmen, Kinder und Jugendliche zu fördern, hilfreich sein könnten?
Das ist ein Prozess, den wir seit vielen Jahren beobachten können. Schon in den 1980er-Jahren gab es erste Modellprojekte mit Schulsozialarbeit. Schon damals hat man gemerkt, es geht für Kinder und Jugendliche in der Schule nicht nur um Deutsch und Mathe, sondern auch um viele andere Themen und Herausforderungen auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Und genau in diesem Sinne kann Jugendarbeit ein Weg sein, die Unterrichtsschule mit anderen Lernfeldern, mit anderer Ansprache und anderen Methoden anzureichern. Gleichzeitig ist das auch eine Chance für die Akteure der Jugendarbeit, zu obligatorischen Partnern im Aufwachsen für Kinder und Jugendliche zu werden (nicht nur für eine kleine Gruppe, sondern tendenziell für alle), so wie etwa die KiTa für alle noch-nicht schulpflichtigen Kinder selbstverständlich geworden ist. Schule ist nun mal der Ort, wo man alle Kinder und Jugendlichen trifft, wo man alle begeistern und für sich gewinnen kann.
Schulz: Ich kann mich da über weite Strecken anschließen. Es bedarf eines erweiterten Bildungsbegriffs, so dass Kinder und Jugendliche nicht nur formal qualifiziert werden, sondern auch beispielsweise durch Angebote der Jugendarbeit Möglichkeiten bekommen, zu tun, was auch zum Erwachsenwerden dazu gehört, zum Beispiel Autonomieerfahrungen zu sammeln, die im Schulunterricht keine große Rolle spielen, oder sich selbst kompetent in Dingen zu erleben, die außerhalb von schulischen Curricula liegen, sich erproben zu können. Diese Dinge sind mindestens genauso wichtig im Leben. Gerade durch den Ausbau des Ganztagsangebots im Primar- und Sekundarbereich kann und muss Jugendarbeit hier eine Rolle spielen.
baugerüst: In den letzten Jahren hat sich evangelische Jugendarbeit grundsätzlich verändert, Kinder haben immer weniger Zeit für außerschulische Aktivitäten. Wenn 2026 der Ganztagsanspruch kommt: Was wird sich im Bereich Vereins- und Jugendarbeit tun? Welche Chancen, welche Risiken bringt der Anspruch mit sich?
Rauschenbach: Für die berufliche Jugendarbeit sehe ich überhaupt keinen Grund, besorgt zu sein. Ich bleibe bei dem Punkt, den ich schon genannt habe: Die KiTa hat den Anspruch, für alle Kinder da zu sein. Mich hat an der Jugendarbeit, die ich eine Zeit lang leidenschaftlich gern selbst gemacht habe und die mich geprägt hat, immer ein wenig gestört, dass sie nicht den gleichen Anspruch hat, möglichst alle, jedenfalls viele, zu erreichen. Die Schule ist nun mal der Ort, wo alle Kinder und Jugendlichen hin müssen, auch etwa diejenigen, die sonst überhaupt keinen Zugang zur Jugendarbeit, oder gar zur kirchlichen Jugendarbeit hätten.
Daher solle man diese Ausgangslage als Herausforderung annehmen und sagen: Es ist toll, wenn die Jugendarbeit endlich einen Zugang zu allen Kindern und Jugendlichen erhalten könnte und nicht nur zu den behüteten, bildungsnahen und vielleicht familiär vorgeprägten. Das ist eine Chance, die man unbedingt nutzen sollte, auch wenn es unbestritten eine große Herausforderung ist. Viele, auch ich, haben die Jugendarbeit immer als eine Art Gegenwelt zur Schule erlebt. Insofern hatte das immer etwas Befreiendes. Aber es zeigt sich halt auch, dass heute vieles anders ist als vor 30 oder 40 Jahren, dass das Aufwachsen nicht mehr einfach so „auf der Straße“ stattfindet, dass die Kommerzialisierung und Digitalisierung das Aufwachsen fundamental verändert hat. Wir müssen also auch hier neu denken, die Jugendarbeit im 21. Jahrhundert neu kontextualisieren. Und dabei sollte auch die bisherige Annahme hinterfragt werden: Die Schule ist mächtig und die Jugendarbeit dagegen schwach. Demzufolge verwendete man die der Jugendarbeit gerne die programmatische Formel: „Alles, was mit Schule in Berührung kommt, wird zur Schule“, wird mithin toxisch. Das sehe ich bei weitem nicht mehr so. Die Schule ist dabei, sich dramatisch zu verändern. Und alle externen Akteure tragen dazu bei.
Schulz: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 2026 gibt Eltern jetzt erst mal das unverbrüchliche Recht auf einen Ganztagsbetreuungssplatz. Es wird einen Platzausbau geben müssen und die Träger der öffentlichen Jugendhilfe müssen gewährleisten, dass Eltern, die einen Platz anmelden, einen bekommen. Das heißt, es wird mehr Kinder im Ganztag geben, als es jetzt ohnehin schon gibt. Es bleibt aber ein Angebot, denn wir haben keine Ganztagsschulpflicht in Deutschland, auch wenn viele Eltern beispielsweise aus beruflichen Gründen den Bedarf nach Ganztag haben oder haben werden. Jugendarbeit kann nicht überall ein verlässliches Betreuungsangebot machen, weil sie sehr oft ehrenamtlich organisiert ist und viele der Ehrenamtlichen ja selbst noch Schüler:innen oder Studierende sind. Was sie aber sehr wohl kann und sollte ist, durchaus mit breiter Brust in diese professionellen Betreuungssettings hineingehen und Kindern und Jugendlichen Angebote machen. Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen verändern sich auf jeden Fall und die Jugendarbeit kann sich flexibler als die Schule darauf einstellen und Kindern Formen und Inhalte anbieten, die es dort sonst nicht gibt. Ich bin ganz bei Herrn Rauschenbach, dass man seitens der Jugendarbeit die Schule nicht mehr mit spitzen Fingern anfassen sollte. Schule ist auch auf Kooperationen angewiesen. Und vor allem geht es für die Jugendarbeit darum, das, was man kann, im Sinne von Kindern und Jugendlichen einzubringen.
Rauschenbach: Noch ein Beispiel dazu aus dem Bereich Sport: Es gibt auf der einen Seite den Schulsport, auf der anderen Seite den Vereinssport. Und trotzdem haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Jugendsportorganisationen von Anfang den Ganztag aktiv mitgestaltet. Die hätten ja auch fragen können: Verdrängen wir damit vielleicht den Schulsport und die dafür ausgebildeten Lehrkräfte oder entwerten wir dadurch die Sportvereine und ihre Angebote? Die Erfahrung hat dann aber gezeigt, dass alle davon profitieren können, dass Kinder dadurch eher mehr Sport machen und in der Summe auch mehr Kinder durch den sportbezogenen Ganztag den Zugang zu den Sportvereinen finden. Ich würde also in dieser Hinsicht für mehr Gelassenheit plädieren und dazu, die Herausforderung der Mitgestaltung des nicht-unterrichtlichen Teils der ganztägigen (Grund)Schule anzunehmen. Durch den nahenden Rechtsanspruch besteht nun die erneute Chance, das Thema Ganztag auch in der Jugendarbeit neu aufzusetzen. Ich glaube, Jugendarbeit muss sich im Jahr 2023 dazu bekennen, eine gute und ergänzende Rolle im Ganztag zu spielen.
baugerüst: Was könnte diese Rolle beispielsweise sein?
Rauschenbach: Ein Punkt, der bislang beispielsweise in vielen Ländern noch nicht gut geklärt ist, ist die Herausforderung, dass mit dem Rechtsanspruch ab 2026 auch die Ferienbetreuung organisiert und verbindlich angeboten werden muss. Und die Kinder- und Jugendarbeit ist einer der profundesten Partner, wenn es um Ferienangebote geht. Das wäre beispielsweise eine tolle Möglichkeit, vor Ort – oder auch in Freizeiten – spannende, interessante und kindgerechte Angebote anzubieten. Viele Schulen wären froh, wenn sie hierfür gute Partner hätten. Auch wenn in der Grundschule die Zuständigkeit vielfach bei den Kitas und Horten liegen, kann auch die Jugendarbeit für diese Altersgruppe viel anbieten. Jugendarbeit hat in der Summe jedenfalls extrem viele Kompetenzen zu bieten, die bereichernd für die Schulen wären.
Schulz: Das würde ich gerne ergänzen. Wenn man an Themen wie Umwelt- oder Tierschutz oder Formen wie Gruppenspiele denkt, gibt es im Bereich der Jugendarbeit und -verbände viele Angebote, die auch für die Grundschule passend wären. Das gilt auch für viele andere Themen, wie vieles, was sonst in der Gruppenstunde eines Verbands stattfände. Warum sollte das nicht auch in der Grundschule eine Rolle spielen können? Auch die Altersstruktur in offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen verändert sich, die Besucher:innen werden jünger. Kinder werden heute schneller erwachsen.
In Nordrhein-Westfalen diskutieren wir derzeit die Frage, welche pädagogischen Qualifikationen und welche Fachkräfte wir zukünftig im außerunterrichtlichen Ganztag der Grundschulen benötigen und der einhellige Tenor ist: Wir brauchen möglichst verschiedene aus verschiedenen Bereichen, zusätzlich zu Erzieherinnen und Erziehern. Wir brauchen Leute, die etwas von Handwerk verstehen, wir brauchen Erlebnispädagogen, wir brauchen Menschen, die den sich entwickelnden Kindern interessante und anschlussfähige Angebote machen können. Da sind wir bei der Jugendarbeit. Ich finde, da gibt es in der Jugendarbeit sehr viele thematische Ansätze und Formen, die man zum Beispiel im Rahmen eines AG-Angebots wunderbar umsetzen kann. Natürlich stellt sich dann auch die Frage nach der Finanzierung und wie das in den Tagesablauf der Grundschule passt, das sind dann die Rahmenbedingungen, über die man sprechen muss.
Rauschenbach: Was ich für kompliziert halte und wo man keine falschen Erwartungen formulieren sollte, ist, dass der Ganztag mit Hilfe des Ehrenamtes organisiert werden kann. Das kann nicht funktionieren, wäre eine strukturelle Überforderung. Man muss in ein eingespieltes Team von Fachkräften reinkommen können, das nicht gleich in Panik gerät, wenn ein Ehrenamtlicher mal nicht kommen kann. Ehrenamt kann mithin nur ein ergänzendes, durchaus belebendes Element sein. Das zeigt sich in vielen Kommunen, bei denen Honorarkräfte in ein professionell organisiertes Konzept eingebaut werden. Sobald nämlich ein Angebot verbindlich und verlässlich sein muss, muss derjenige, der es verantwortet, es auch vertraglich absichern – und das ist keine Basis für ehrenamtliche Arbeit. In der Jugendarbeit engagiert man sich als junger Mensch aber, so war es zumindest bei mir, weil es einen begeistert und man sich wertgeschätzt fühlt, weil man eine Aufgabe übernehmen, weil man etwas Neues lernen und erfahren darf. In diesem Sinne sollte das Ehrenamt auch geschützt werden – oder klar zu einer freien Mitarbeit als Honorarkraft umgewandelt werden.
Schulz: So wollte ich natürlich auch nicht verstanden werden. Ich sehe es auch so, das kann nicht ausschließlich mit Ehrenamtlichen laufen.
baugerüst: Wird dann keine außerschulische Jugendarbeit mehr stattfinden, weil Schüler, die den ganzen Tag in der Schule sind, abends völlig am Ende sind?
Rauschenbach: Das würde ich nicht sagen. Das ist doch wie beim Sport: Die Sportvereine sind ja nicht tot, nur weil die Kinder nachmittags schon Sport machen, sondern es gibt immer welche, die noch mehr haben wollen, die durch die Schule erst auf den Geschmack gekommen sind. Ich würde das nie als Konkurrenz sehen. In den wenigsten Fällen geht die Ganztagsschule aktuell bis 17 Uhr, viele enden ja zwischen 15 und 16 Uhr. Zu dieser Zeit können die Kinder danach doch noch problemlos ein, zwei Stunden in die Jugendarbeit gehen. Zudem sind wir in Deutschland weit davon entfernt, dass die Kinder von Montag bis Freitag jeweils bis 17 Uhr in die Ganztagsschule gehen; da bleiben noch genügend Freiräume. Das Zeitmanagement von Kindern ist heute ein ganz anderes. Ich würde bei diesem Thema gerne ein bisschen die Luft rausnehmen, das klingt für mich immer wie ein Schutzargument. Ich bin überzeugt, dass beides auch in Zukunft nebeneinander möglich ist. Auch könnte sich die Jugendarbeit künftig etwas stärker auf die
Wochenenden und die Ferien konzentrieren. Derartige Entwicklungen können wir ja auch in anderen Ländern beobachten.
baugerüst: Wie ist das denn in anderen Ländern? Da ist der Ganztag ja schon seit Jahren Realität, wie funktioniert das dann da?
Rauschenbach: Dort gibt es vielfach keine klassische Jugendarbeit wie hier, das konzentriert sich mehr auf die Ferien. In Frankreich sind die Kinder zum Beispiel wochenlang in den Sommerferien auf Ferienlager, während unter der Woche es aufgrund eines ganztägigen Unterrichts keine Angebote gibt. Vor einigen Jahren haben wir bei Recherchen zum Thema „Jugendarbeit auf dem Land“ aus Mecklenburg-Vorpommern immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass dort viele vor Ort gar nicht die Möglichkeit, sich täglich, beziehungsweise unter der Woche ortsnah, persönlich zu treffen, da sie zu weit voneinander entfernt wohnen. Infolgedessen vernetzen sie sich digital und treffen sich nur am Wochenende oder in den Ferien. Mit anderen Worten: Vor Ort ist in kleineren Gemeinden oft gar nicht mehr die Potenz da, eine Kinder- oder Jugendgruppe zu organisieren, zumal Grundschulkinder ja auch nicht mobil sind und einfach irgendwo hinfahren können. Meiner Meinung nach muss die Bereitschaft und das Interesse an einer nicht-schulischen Begleitung der Kinder und Jugendlichen da sein, etwas mit ihnen machen zu wollen – und dann schaut man, wie sich das realisieren lässt.
Schulz: Ich erinnere mich an Gespräche mit Trägern der katholischen Kinder- und Jugendarbeit, die in in NRW in der Sekundarstufe I den Ganztag mitorganisiert haben. Die haben gesagt, sie seien als Stadtverband in die Ganztagsschule eingestiegen und würden dort ihre Themen und Angebote in Kooperation mit verlässlichen Honorarkräften einbringen. Im besten Fall haben Kinder und Jugendliche dann Lust, nach der Schule in der Jugendarbeit weiterzumachen. Man muss ja auch sehen, dass es zum einen natürlich um spezielle Themen geht, aber auch um Beziehungen. Auf der einen Seite die über den Klassenverband hinausgehende Beziehung zu den Peers, auf der anderen Seite zu älteren Jugendlichen, die diese Angebote durchführen. Man erreicht in der Schule einfach Kinder, die man sonst nie erreichen würde, davon kann Jugendarbeit profitieren. Meine Erfahrung ist, dass sich da produktive Synergien ergeben können.
baugerüst: Welche Unterschiede gibt es zwischen Süden und Norden, Osten und Westen, zwischen ländlichen Gebieten und Münchner Innenstadtschulen mit Blick auf den Ganztag?
Rauschenbach: Die Nachfrage ist erwartungsgemäß in ländlichen Regionen etwas geringer. Das kann man in jedem Bundesland beobachten, da dort verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Netzwerke noch anders funktionieren als in städtischen Milieus. Diese Unterschiede wird man sehen, was den Bedarf, aber auch was die Möglichkeiten angeht. Man wird in Niederbayern, im Münsterland oder im Schwarzwald ja auch nicht haufenweise arbeitssuchende Fachkräfte finden, die problemlos Ganztagsangebote machen können.
Und dennoch sollte man sich immer wieder klar machen, dass, wie gesagt, die Organisation mit Ehrenamtlichen keine Lösung ist, wenn der Staat gleichzeitig per Gesetz Verbindlichkeit und Verlässlichkeit einklagt. Die Eltern können nicht den ganzen Nachmittag in Sorge sein, ob ihr Kind im Ganztag vernünftig untergebracht ist. Diese Verlässlichkeit muss organisiert werden, dafür müssen Ressourcen bereitstehen und dafür ist auch Geld eingeplant.
Schulz: Für ländliche Regionen kann das auch eine Chance sein. Wenn wir Schulzentren in den mittelgroßen Zentren haben, in denen Jugendliche aus umliegenden Gemeinden zusammenkommen, dann besteht an diesen Orten die Chance, viel mehr zu bieten als nur Unterricht. Dann habe ich als Jugendarbeit die Möglichkeit, die Jugendlichen dort zu erreichen und ihnen ihren Interessen entsprechende Angebote zu machen, die sie auch nutzen möchten. Die hätten ja, wie Herr Rauschenbach ausgeführt hat, sonst gar nicht die Möglichkeit, sich am Nachmittag anders zu treffen, weil die räumlichen Distanzen so groß sind.
baugerüst: Was wünschen Sie sich von evangelischer Jugendarbeit mit Blick auf die Schule?
Rauschenbach: Ich bin in der Evangelischen Jugendarbeit groß geworden. Zunächst Mal fühlte ich mich immer angenommen, als Teil einer Gemeinschaft, habe mich mit
Fragen der protestantischen Wertorientierung auseinandergesetzt und auch die evangelischen Rituale erlebt und praktiziert. Demgegenüber ist Schule richtigerweise säkular. Daraus folgt: Entweder wird die evangelische Jugendarbeit sich als Anbieter mit seiner eigenen Mission zurückhalten oder sie so klar deklarieren, dass ein Muslim dort zum Beispiel gar nicht hingeht.
Ich rate eher zu missionarischer Zurückhaltung und stattdessen zu einer Orientierung an guter Jugendarbeit und praktizierender Nächstenliebe. Die, die sich dann wohlfühlen, die kommen vielleicht auch am Wochenende in die evangelische Jugendgruppe oder fahren vielleicht auf eine Freizeit mit. Schule ist für eine konfessionsgebundene Jugendarbeit ein Eingangstor, um erst mal einen Zugang zur Jugendarbeit zu finden und Kinder und Jugendliche dazu einzuladen. Man muss sich dabei auch nicht vor wertorientierten Themen verstecken. Junge Menschen suchen hier ihre eigene Position. Wir haben früher so viele Debatten als Jugendliche in der evangelischen Jugendarbeit geführt, über die Todesstrafe, über Krieg, über Fairness, über Armut. Das sind alles wichtige, hochmoralische und ethische Themen, die in der Schule vielfach gar nicht so oft vorkommen.
Schulz: Ich bin zwar in der katholischen Jugendarbeit groß geworden, aber ich kann mich Herrn Rauschenbach ohne weiteres anschließen. Ich finde vor allem die Möglichkeit, Themen zu setzen, auf denen nicht unbedingt „Gott“ oder „evangelisch“ oder „Bewahrung der Schöpfung“ draufstehen muss, die aber übersetzt werden können und mit den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen zu tun haben, das ist wichtig. Da unterscheiden sich Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbände auf den ersten Blick gar nicht sehr. Erst in zweiter Linie geht es um die spezifische, nuancierte Wertorientierung der verschiedenen Verbände. Vor allem geht es doch darum, dass sich die Kinder und Jugendlichen in einer für sie und ihre Bedürfnisse produktiven Umgebung wohlfühlen und dass Beziehungsarbeit stattfinden kann.
baugerüst: Vielen Dank.
Du hast Interesse am Thema „Jugendarbeit und Schule“?
Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 2/23 Jugendarbeit und Schule.
Titelbild: Schultüten unter einem Tisch. (Foto: Arnica Mühlendyck)
Share On [Sassy_Social_Share]



Rückmeldungen