Wo bleibt Raum für Langeweile?
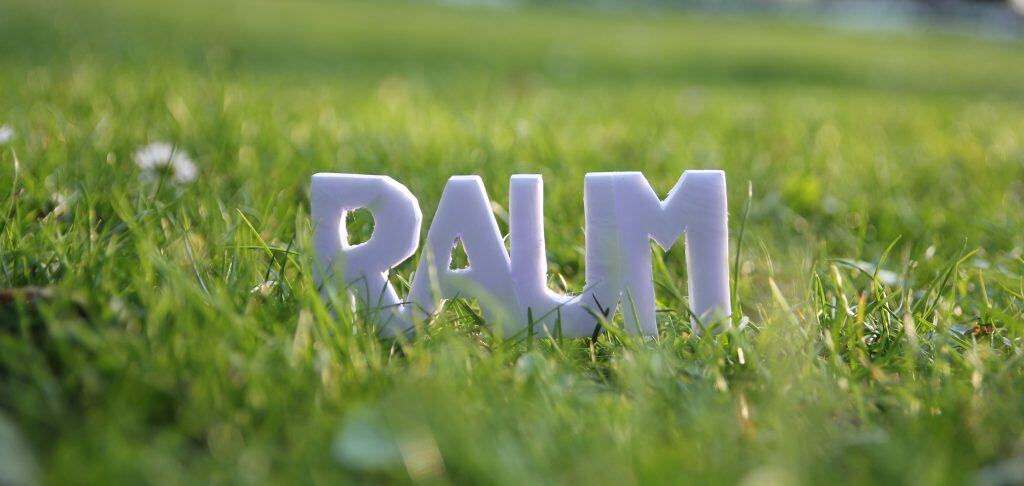
Lesezeit: 14 Minuten
Ausgabe 3/25 Langeweile
Janine Frisch ist Diakonin und Sozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt digitale Jugendarbeit und Jugendkulturarbeit. Sie arbeitet als Fachreferentin im Referat Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Torge Peterson ist Diakon und Religionspädagoge mit dem Schwerpunkt Arbeit mit Kindern und Übergänge in die Jugendarbeit. Er arbeitet als Fachreferent im Referat Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.
Langeweile in der Kinder- und Jugendarbeit
Wenn wir über Langeweile nachdenken, ist das erst einmal kein erstrebenswerter Zustand. Trotzdem erleben ihn alle Menschen – ungeplant, ungewollt und unvermeidbar. Das gilt genauso für Kinder und Jugendliche. Wo ist Langeweile Thema und Aufgabe in der Kinder- und Jugendarbeit?
Julian wird um 6:30 Uhr von seinem Vater geweckt: „Guten Morgen, Julian, das Frühstück ist fertig. Du musst aufstehen.“ Um 7:15 Uhr verlässt Julian das Haus. Im Schulranzen befindet sich neben den Heften, dem Mathe- und Deutschbuch, dem Federmäppchen auch eine Dose mit Brot und Obst, sowie eine Flasche Wasser. Der Schultag des 13-jährigen Siebtklässlers dauert bis um 14:45 Uhr, von 15 bis 16:30 Uhr ist Forschungs-AG; sie basteln an einem Solarauto. Zuhause ist er dann um 17 Uhr. Dann folgen Hausaufgaben, Abendbrot, eventuell noch eine Folge der Mini-Serie und dann um 21 Uhr ab ins Bett.
„Glücklicherweise,“ denkt sich Julian, „kann ich zwischendurch noch meinen Freunden bei Instagram folgen und gucken, was bei ihnen so abgeht. Vielleicht schaffe ich auch noch die nächste Folge von „Adolesence“ bei Netflix. Adrian hat die Serie schon durchgebingt und gesagt, dass ich das unbedingt gucken muss. Er kann gar nicht mehr ruhig schlafen.“
Am nächsten Morgen wacht Julian schweißgebadet auf. Er hatte einen Alptraum von „Adolesence“. Wie soll er sich heute nur auf den Aufsatz in Deutsch konzentrieren? Er muss unbedingt mit Adrian über die Serie reden. Da kommt sein Vater herein. „Du bist ja schon wach, Julian, ist irgendwas los?“ „Ne, alles okay.“ „Na, dann spring in deine Klamotten, du musst heute früher los, das Busunternehmen streikt.“ „Scheiße!“ „Mama fährt dich. Jetzt aber los! Und denk dran, deine Sportsachen mitzunehmen, heute Abend ist Handball-Training. Mama hat dir 10 Euro hingelegt, für ein Mittagessen zwischendurch.“ „Oh, ne, ey, ich hab keinen Bock.“ „Na, komm schon, in zwei Wochen sind Ferien. Du schaffst das!“
Adrians Smartphone haut ihm um 6:30 Uhr den harten Rap von Farid Bang um die Ohren. Zack, Schlummern! Noch 10min. Um 7:10 Uhr quält er sich aus dem Bett. Hektisch packt er seine Schulsachen zusammen. „Bloß nichts vergessen, sonst gibt’s echt Stress!“ ermahnt er sich. Er hat seiner Mutter versprochen, dass es nicht sitzen bleibt. Sie hat schon genug Ärger. Da will er sie nicht noch mehr belasten. Seit sein Vater den Unterhalt nicht mehr zahlt, putzt sie vor ihrer Arbeit im Büro noch in der Firma nebenan. Adrian muss deshalb seit 8 Wochen allein aufstehen. Anfangs war das cool, jetzt fehlt ihm seine Mutter immer mehr. Abends schläft sie auf dem Sofa ein und hört ihm kaum noch zu. „So viel rede ich ja auch nicht“, resigniert er. Seinen Vater möchte er gerne mal treffen, aber beim Streit mit seiner Mutter war er echt ein Arsch. Also Funkstille! Als er heute nach Hause kommt, ist er sauer auf sich selbst. Den Deutschaufsatz hatte er nicht mehr auf dem Schirm. „Das wird maximal ne 4!“ stöhnt er. In Mathe würde ihm das nicht passieren. Da läuft es. Wie bei seinem Vater, dem Ingenieur. Seine Mutter würde sich über eine gute Zensur in Deutsch richtig freuen. Ihr Studium in Kunstgeschichte hatte sie an den Nagel gehängt, als sie mit ihm schwanger wurde. Jetzt trauert sie den verpassten Möglichkeiten nach und wünscht sich, Adrian würde sich mehr für Literatur interessieren. Fantasy mag er, aber diese schrillen Mangas und blutigen Monsterspiele… Nix für seine Mutter.
Die Sport AG lässt er ausfallen. Beim Parkour auf dem Schulhof hat er sich den Fuß verdreht. Wie lieb Marlene ihm geholfen hat. Sie duftet so gut. Sagen kann er ihr das nicht. Schiebt lieber einen harten Spruch raus. Sie verdreht die Augen. Jungs!
Er humpelt zum Getränkemarkt, wo er Kisten stapelt. Geld verdienen für seinen Smartphone-Tarif und Netflix. Am Abend beißt er die Zähne zusammen. Mama soll sich keine Sorgen machen. Morgen wollte er sich eigentlich mit Julian verabreden, aber der hat wieder mal keine Zeit. So bleibt ihm wieder nur der PC. Next Level.

Foto: medienREHvier.de / Björn Meyer
So oder so ähnlich könnte der Alltag von jungen Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, aktuell aussehen. Die Verdichtung von Wegzeiten, verlängertem Schultag und anderen Aktivitäten führt zu weniger freien Zeit und weniger Zeit mit Freunden sowie der Familie. Diese Beobachtung machen wir in der Kinder- und Jugendarbeit schon länger, doch was bedeutet Langeweile in diesem Zusammenspiel? Der Text über Julian und Adrian zeigt Langeweile als Symptom. Inmitten von Terminen, Pflichten und digitalen Ablenkungen offenbart sich eine Leere, die nicht durch Beschäftigung, sondern durch Sinnlosigkeit entsteht.
Julian lebt einen Alltag, der auf den ersten Blick vor Aktivität nur so strotzt. Schule, AG, Hausaufgaben, Sport, Serien, Social Media – sein Tag ist minutiös gefüllt. Doch zwischen den Zeilen spürt man: Er lebt nicht, er funktioniert. Selbst Freizeit wird zur Pflicht, wenn er Serien „durchbingen“ muss, um mitreden zu können. Die Langeweile, die Julian empfindet, ist keine Folge von Leerlauf, sondern von Fremdbestimmung. Seine Gedanken kreisen nicht um eigene Interessen, sondern um Erwartungen – von Eltern, Schule, Freunden.
Adrian hingegen lebt in einer anderen Realität. Seine Langeweile ist emotionaler Natur. Er ist allein, überfordert, und trägt Verantwortung, die nicht altersgerecht ist. Seine Mutter ist erschöpft, sein Vater abwesend. Die Schule ist für ihn nicht nur Lernort, sondern auch Bühne für Selbstbehauptung und Sehnsucht. Er sehnt sich nach Anerkennung, nach Nähe – und findet sie nicht. Stattdessen flüchtet er sich in Games, harte Sprüche und Tagträume. Seine Langeweile ist die Stille nach dem Lärm, das Gefühl, dass niemand wirklich zuhört.
Langeweile kann durch Fremdbestimmung entstehen – oder durch mangelnde Resonanz
Beide Jungen zeigen, dass Langeweile nicht nur ein Mangel an Beschäftigung ist, sondern ein Mangel an Resonanz. Sie erleben ihre Umwelt als fordernd, aber nicht fördernd. Ihre Interessen – ob Solarauto oder Mangas – bleiben oberflächlich, weil ihnen der Raum fehlt, sich wirklich zu entfalten. Medienkonsum wird zum Ersatz für echte Begegnung, zum Versuch, die innere Leere zu füllen.
Was hat Kinder- und Jugendarbeit mit dieser Langeweile zu tun?
Jugendliche, die auf öffentlichen Plätzen herumhängen und nichts mit sich anzufangen wissen. Das ist nicht die Langeweile, die wir im Alltag unserer Protagonisten entdecken. Doch es ist eine Situation, für die die Angebote der Jugendarbeit eine Antwort sind. In der Frühgeschichte schließt Jugendarbeit, je nach Epoche, eine Lücke „zwischen Schule und Kaserne“ oder „zwischen Schule und Ausbildung“1. Damit ist sie eine Entwicklung, die sich auch aus der entstandenen Freizeit in der eigenständigen Jugendphase ergibt.
Raum, die Gedanken schweifen zu lassen – raus aus dem Alltag
In den letzten Jahrzehnten bietet insbesondere offene Jugendarbeit eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Lücke zwischen Schule und der Rückkehr der Eltern von der Erwerbstätigkeit. An vielen Stellen steht aktuell zur Debatte, inwieweit die Akteure der Kinder- und Jugendarbeit bei der Gestaltung der Ganztagsbildung mitwirken. Die Ausweitung der Ganztagsbetreuung bedeutet eine Ausdehnung der Kontrolle der freien Zeit der Schülerinnen und Schüler und damit einen weiteren Rückgang der selbst gestaltbaren Zeit. Dazu steht zur Diskussion, wie das mit den Grundprinzipien der Kinder- und Jugendarbeit (Freiwilligkeit, Offenheit, Sensibilität für Vielfalt, altersgemäße Beteiligung, Selbstwirksamkeit und -organisation, Subjekt- und Lebensweltorientierung) vereinbar ist.
Was bedeutet das für die Kinder- und Jugendarbeit?
Die Evangelische Jugend schafft als einer der großen Jugendverbände Angebote mit und für Kinder und Jugendliche. Wie die Angebote aussehen, hängt von Konzept, Person, Ort, Zielgruppe und noch anderen Faktoren ab. Wo kommt da vielleicht schon Langeweile vor? Im Folgenden beschreiben wir exemplarisch vier Formen der Kinder- und Jugendarbeit , in denen Langeweile ihren Platz hat bzw. vorkommen kann.
1. Zeitlich befristetes Projekt
Drachenbau. Sechs Wochen lang, jeden Mittwoch, treffen sich die jungen Leute im Gemeindehaus zum Drachenbau. Nach einem kurzen Input zum Thema suchen alle ihren „Drachentypen“ aus. Dann beginnt das Basteln. Der Werkraum im Keller ist gut ausgestattet. Hier kann die Kreativität Raum greifen. Nachdem erstmal alle ein individuelles Modell gewählt haben, geht es an die Konstruktion. Einige helfen sich gegenseitig, andere basteln still vor sich hin, wieder andere kommentieren jeden ihrer Arbeitsschritte. Zwischendurch bleibt Zeit zum „Smalltalk“. Natürlich über die Schule, aber auch über Familie, Freunde und Freundinnen. Es ist fast andächtig, wenn die zehn Jugendlichen mit Kleber und Holz nebeneinander ihre Drachen gestalten. Irgendwann muss auch der letzte Drachen fertig werden, denn die Dinger wollen in die Luft. Der Wind weht gut, nicht zu stark. Die Wiese neben der Kirche ist ideal gelegen. Jetzt steigen die Drachen in die Luft. Und stehen dort. Einfach so. Eine lange Weile. Nichts anderes ist in diesem Moment wichtig. Nur der Drache und ich.
Langeweile heißt hier, Raum zu haben, die Gedanken schweifen zu lassen, aus dem Alltag auszubrechen und sich in etwas anderes zu vertiefen. Dabei ist der vorgegebene Rahmen, der mich einlädt, mich einer bestimmten Aufgabe zuzuwenden, wichtig. Die Zeit sollte insgesamt angemessen gewählt sein und es sollte eine bedarfsgerechte, vielleicht gegenseitige Unterstützung eingeplant werden, damit kein unangenehmer Leerlauf entsteht und alle am Ende ein Erfolgserlebnis haben.
2. Jugendfreizeit
Das Haus am See – in Dänemark. 25 junge Leute zwischen 13 und 17 Jahren erleben an der dänischen Nordseeküste eine gemeinsame Freizeit. Kennenlernen und der Alltag bestimmen die ersten Tage. Selbstversorgerhaus bedeutet für einige, erstmals selbst richtig zu kochen; nicht nur für sich allein, sondern für eine ganz Gruppe. Erfahrene Teamer:innen begleiten die Kochgruppen, geben Tipps und unterstützen. Natürlich ist der Strand das Highlight. Hier klatschen die Wellen an den Strand, Surfer:innen reiten die Wellen und motivieren die Freizeitteilnehmer:innen. Einige sitzen in den Dünen und schauen aufs Wasser. Abends gibt es kreative Angebote und Musik mit der Gitarre. Dazwischen bleibt Zeit für jede:n Einzelne:n und für Kleingruppen. Ob das Langeweile ist? Jedenfalls fühlt es sich nicht so an. Zum Ende der Freizeit haben alle einen Platz gefunden, an dem sie sich wohlfühlen, wo sie sie selbst sein können.
Wenn wir an Freizeiten denken, dann denken wir nicht an Langeweile. Trotzdem konnten wir sie beim Nachdenken finden. In den Phasen, wo die Gruppe sich findet und einige vielleicht noch etwas einzeln unterwegs sind. In der freien, selbst gestaltbaren Zeit, in der einige vielleicht nichts anzufangen wissen. In dem Warten auf andere oder auf den verspäteten Bus. Vielleicht ist die Langeweile in den Pausen hier um so wichtiger, damit wir die Aktivität und die neuen Erfahrungen in guter Erinnerung behalten. Solange sie nicht zu dem unangenehmen Gefühl wird, diese Situation schnell verlassen zu wollen.
Langeweile kann Raum für Selbstbestimmung und Gestaltung schaffen
3. Wöchentliches Gruppentreffen
Meistens sind Leas Schultage lang. Viel freie Zeit bleibt in der Woche nicht. Gottseidank sieht sie ihre beste Freundin da jeden Tag in der Schule. Sie wohnen nicht weit auseinander und haben beide eigene Smartphones. Da sind sie die ganze Zeit in Kontakt. Den beiden ist ein Nachmittag in der Woche heilig – der Donnerstag. Dann trifft sich die Jugendgruppe im Gemeindehaus um die Ecke und sie gehen beide hin. Lea hat sie kennengelernt, als sie zur Konfizeit die verschiedenen Angebote der Kirchengemeinde vorgestellt bekommen hat. Die Teamer:innen waren cool. Da hatte sie sofort das Gefühl, dass sie da kann, wie sie ist. Keine Erwachsenen und auch nicht die „komischen“ Leute, die sie in der Schule schon anstrengend findet. Hier haben sie einfach Zeit zu quatschen und zusammen mit den anderen zu überlegen, was sie machen wollen. Manchmal ist das dann gar nicht viel.
Wöchentliche Angebote für Jugendliche sehen anders aus als für Kinder. Kinder bringen einen ganz eigenen Blick auf die Welt, altersgemäße Neugierde und Energie mit in die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem ist die Berücksichtigung der Familie wichtiger als bei den jungen Heranwachsenden. Jugendliche sind auf der Suche nach sich selbst, nach Grenzen und Gemeinsamkeiten mit anderen. Beide Altersgruppen haben ein Bedürfnis nach Pause und Entspannung. Sie brauchen Zeit und Raum, ihre Interessen zu entdecken und sie dann auch auszudrücken. In Momenten der Langeweile können diese ihren Raum zur Entfaltung finden.
4. Jugendzentrum
Mitten in der Wohnsiedlung ein Bungalowbau aus den Achtzigern; ein kleines Haus im Hinterhof neben einer Schule; das ganze Untergeschoss eines Gemeindehauses – Jugendzentren sehen von außen ganz verschieden aus. Genauso wie die jungen Menschen, die ihre Angebote nutzen. Die offene Jugendarbeit in festen Räumen bietet ein niederschwelliges und zugleich sinnvolles Freizeitangebot. Dabei ist es unterschiedlich, wie sehr die Räume durch ihre Einrichtung zu festen Aktivitäten (Tischtennis, Kicker, Billard, Theke, Couchen, Arbeitsplätze, Gym) einladen oder Platz zur eigenen Gestaltung lassen. Diese Form der Jugendarbeit steht im stärksten Gegensatz zu den sonst durchfunktionalisierten Institutionen, die Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag erleben. Hier ist Raum (vor, in und um Jugendzentren) und Zeit für soziale Gruppen-
arbeit, jugendkulturelle Prozesse und Experimente, Platz zum Rumhängen und Cliquenbeziehungen, meistens in guter sozialräumlicher Einbindung. Die fehlende Struktur dieses Angebots lässt Langeweile zu und schafft so Anreize für Jugendliche, in ein selbstbestimmtes Handeln und Gestalten zu kommen.

Foto: medienREHvier.de / Anna Janzen
Welche Rolle spielen pädagogische Fachkräfte bei der Gestaltung von Raum für Langeweile?
Die Liste der Kompetenzen, die Fachkräfte für die Kinder- und Jugendarbeit mitbringen sollen, fällt je nach Perspektive unterschiedlich aus. Einige Ideen spiegeln sich in den Ausbildungsprofilen von Studiengängen oder den JuLeiCa Standards ab. Langeweile kommt da in der Regel nicht vor. Dabei zeigen unsere Beispiele, dass Langeweile im Arbeitsalltag eine Rolle spielt. Wir stellen sogar die Frage, ob sie nicht noch mehr Raum bekommen sollte.
Haupt- und Ehrenamtliche brauchen Mut für die langsamen Prozesse
Die Haupt- und Ehrenamtlichen wissen darum, was entwicklungspsychologisch an der Reihe ist und verknüpfen diese Erkenntnisse mit den Interessen der Jugendlichen. In partizipatorischen Prozessen entstehen die Programme für Kinder und Jugendliche. Eine Herausforderung liegt in einer Balance zwischen einem als attraktiv wahrgenommenen Programmangebot und dem Angebot eines Freiraumes zur inneren Entfaltung. Langeweile klingt nicht besonders sexy. In der Realität passieren in der Kinder- und Jugendarbeit ab einer bestimmten Gruppengröße zehn Dinge gleichzeitig. Es ist allein eine Herausforderung für die Mitarbeiter:innen hier den Überblick zu behalten. Wie soll da Raum für Pause, Ruhe und Langeweile sein? Hier ist eine „strukturierende Kompetenz“ gefragt, wie Ulrich Deinet es bezeichnet.2 Manche Situationen können nicht im Detail ge-plant werden, aber durch unsere Rahmenbedingungen und Setzungen kann Raum entstehen: die Lücke, in der sich Aneignungs- und Lernmöglichkeiten entfalten können.
Lasst uns ein Lagerfeuer entfachen, statt nur ein Feuerwerk abzufackeln
Oft planen wir unsere Angebote von vorne bis hinten und gestalten unsere Räume mit vielfältigen Impulsen und Anreizen. Das schafft Sicherheit und die Gruppe genießt das Feuerwerk. Sie staunt über so viele Möglichkeiten und den Ideenreichtum. Ein Lagerfeuer brennt dagegen langsam los. Seine wärmende Kraft entfaltet es erst Stück für Stück. Es braucht Zeit. Zeit, in der einfach nur ins Feuer geguckt werden kann. Wir wollen Mut machen für diese langsameren Prozesse. In ihnen können kreative Ideen entstehen. Die Gruppe kann warm werden mit einem Thema und aktiv mitgestalten.
Die Persönlichkeit reift, wenn wir bewusst Langeweile zulassen
Alle Jugendlichen aus unseren Beispielen profitieren von den Angeboten der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit – auch von den Momenten der Langeweile. Sie erfahren sich als selbstwirksame Wesen, die ihre eigenen Interessen formulieren können. Sie haben Raum, ihre Interessen zu entdecken, sie einzubringen und gemeinsam mit anderen Gleichaltrigen zu reflektieren.
Langeweile sehen wir als den Schlüssel zu innerer Balance, frei nach dem dänischen Familientherapeut Jesper Juul. Wenn wir es schaffen, die Unruhe des Alltags an uns vorbeiziehen zu lassen, kann unsere Kreativität und Gestaltungslust geweckt werden. Langeweile bietet Raum und Zeit für Neues und lässt Entwicklung zu. Wenn wir uns der planerischen Herausforderung stellen, Langeweile zuzulassen, entsteht Raum, in der die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen reifen kann.
Du hast Interesse am Thema „Langeweile“?
Du findest weitere Artikel dazu in der Ausgabe 3/25 Langeweile.
Foto: medienREHvier.de / Anja Brunsmann
Literatur
1 Simon, Titus (2013): Abhängen, Treffen, Warten, Langeweile. In: Deinet, Ulrich ; Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.), Handbuch Offene Kinder- und Jugendarbeit. VS:Wiesbaden
2 Deinet, Ulrich (2010): Konzeptionelle Grundmuster. Kinder- und Jugendarbeit als Medium von Aneignung und Bildung. Baustein A 3.3 der Beteilgungsbausteine des Deutschen Kinderhilfswerkes. www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/4_Praxis/4.6_Beteiligungsbausteine/4.6.1_Grundlagen/4.6.1.3_Zielfindung_und_Konzeptionsentwicklung/Baustein_A_3_3.pdf
Sturzenhecker, Benedikt (2022): Kernkompetenzen sozialpädagogischer Professionalität in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit – auch in Blick auf Jugendarbeit als Care Arbeit. Schriftliche Ausarbeitung des digitalen Vortrages, am 10.11.2021 bei der Fachtagung der AGJF Sachsen für das Projekt MUT-Interventionen. www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew2/sozialpaedagogik/files/anforderungen-an-professionelle-kompetenz-in-der-okja-website-6-3-22.pdf

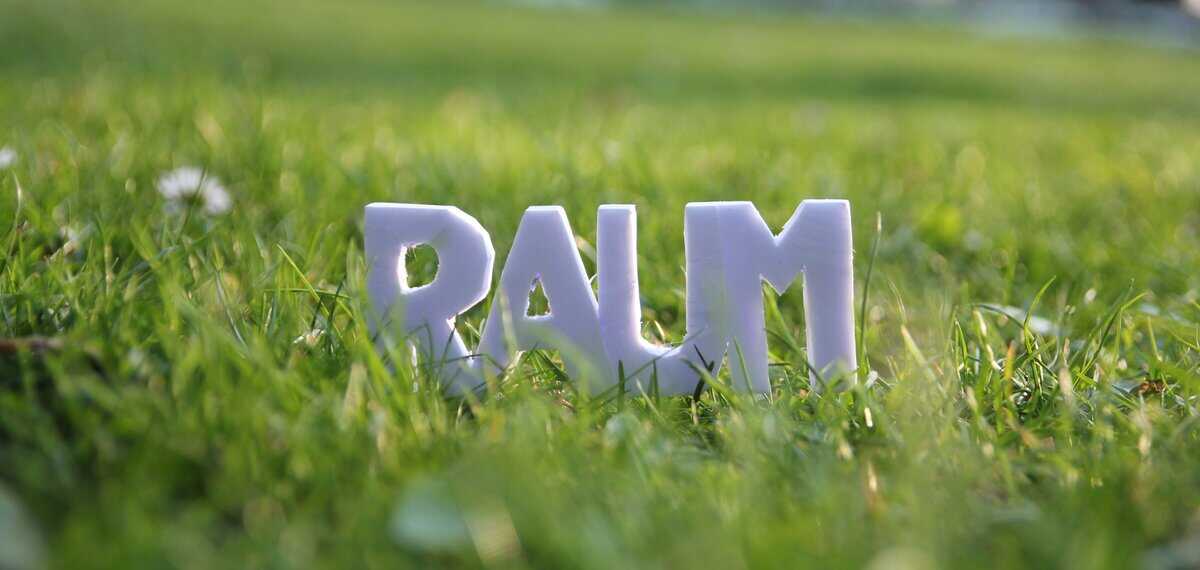
Rückmeldungen